Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG)Das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastrukur-Gesetz (kurz GEIG) regelt den Ausbau der Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur in Deutschland. Ziel des Gesetzes ist der zügige Aufbau einer gebäudeintegrierten Lade- und Leitungsinfrastruktur zur Förderung der Elektromobilität. Dabei geht es konkret um die Errichtung und Ausstattung von Stellplätzen mit Ladesäulen und Schutzrohren für Elektrokabeln in Wohn- und Nichtwohngebäuden.
Zusammengefasst gelten ab dem 01. Januar 2025 folgende Regelungen zum Elektromobilitätsinfrastrukturgesetz:
Wohngebäude
- Neubau von Wohngebäuden mit mehr als fünf Stellplätzen: Jeder Stellplatz muss mit Schutzrohren für Elektrokabel ausgestattet sein.
- Renovierung von Wohngebäuden mit mehr als 10 Stellplätzen: Jeder Stellplatz ist mit Schutzrohren für Elektrokabel auszustatten.
Nicht-Wohngebäude (Betriebe und Einrichtungen)
- Neubau von Nichtwohngebäuden mit mehr als sechs Stellplätzen: Jeder dritte Stellplatz ist mit Schutzrohren für Elektrokabel auszustatten. Es ist mindestens ein Ladepunkt zu errichten.
- Renovierung von Nichtwohngebäude mit mehr als 10 Stellplätzen: Jeder fünfte Stellplatz muss mit Schutzrohren für Elektrokabel ausgestattet sein. Es muss mindestens ein Ladepunkt vorhanden sein.
- Ab 20 Stellplätzen muss grundsätzlich ein Ladepunkt vorhanden sein.
Für wen gilt das Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetz (GEIG) nicht?
- Nichtwohngebäude bzw. Betriebsgebäude im Eigentum von kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) mit max. 249 Beschäftigten, Umsatz von max. 50 Mio. Euro und Bilanzsumme von max. 43 Mio. Euro), die überwiegend selbst genutzt werden
- Wohngebäude und Nichtwohngebäude bzw. Betriebsgebäude, deren Renovierungskosten für die Lade- und Leitungsinfrastruktur sieben Prozent der Gesamtkosten einer größeren Renovierung überschreiten. Dies setzt voraus, dass mindestens 25 Prozent der Oberfläche der Gebäudehülle von der Renovierung betroffen sind.
- Wohngebäude und Nichtwohngebäude bzw. Betriebsgebäude, bei denen die Renovierung 25 Prozent der Oberfläche der Gebäudehülle nicht übersteigt
Hinweise und Erklärungen
- Als Ladepunkt gilt z.B. eine Ladesäule oder eine Wallbox, die das Aufladen eines Elektrofahrzeuges ermöglicht.
- Als Stellplatz gelten lediglich private, nicht öffentliche Flächen. Dazu gehören z. B. auch Tiefgaragen, jedoch keine Ausstellungs-, Verkaufs-, Werk- und Lagerräume für Fahrzeuge.
- Bei gemischter Gebäudenutzung (Wohngebäude- und Nichtwohngebäude) sind jeweils die Gebäudeteile zu berücksichtigen, die als Wohngebäude bzw. Nichtwohngebäude genutzt werden.
- Quartierregelungen: Bei einem räumlichen Zusammenhang von Gebäuden und Nichtwohngebäuden ist die Lade- und Leitungsinfrastruktur auf das Quartier anzuwenden, so dass es bei einzelnen Wohngebäude- und Nichtwohngebäudeeinheiten auch zu Abweichungen kommen kann.
Weltweit mit einheitlichen Symbolen vor Gefahren warnen
Das „Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packing of Chemicals" (GHS) steht für die weltweit einheitliche Gefahreneinstufung und Kennzeichnung von Chemikalien und ist Grundlage für die CLP-Verordnung 2015. Seit dem 26.11.2010 verweist die Gefahrstoffverordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien auf die CLP-Verordnung 2015. Für die Kennzeichnung von Stoffen ist die Kennzeichnung gemäß GHS/CLP seit dem 01.12.2010 gesetzlich vorgeschrieben, bei Gemischen gilt eine Übergangsfrist zum 01.06.2015.
➤ Aktuelle Informationen zur GHS finden Sie unter www.baua.de (Stichwort GHS).
➤ Unsere Sonderseite zur Stoff-Kennzeichnung nach GHS/CLP-Verordnung ab dem 01.06.2015 finden Sie hier.
➤ Hier finden Sie unsere GHS/CLP-Etiketten.
Neuerungen der GHS
Das Einstufungs- und Kennzeichnungssystem für Chemikalien wurde in den letzten Jahren weiterentwickelt und schrittweise geändert. An die Stelle der rechteckigen orangefarbenen Gefahrensymbole mit schwarzem Zeichen sind auf der Spitze stehende weiße, rotumrandete Quadrate mit schwarzem Symbol getreten. Seit dem 01.06.2017 dürfen nur noch Chemikalien mit der neuen Kennzeichnung verkauft werden. Seit diesem Datum sind alle Übergangsfristen abgelaufen!
Die Gefahrenklassen wurden vorher gemäß den nicht mehr geltenden EG Richtlinien nach 15 Gefährlichkeitsmerkmalen gegliedert. Mit der Umstellung auf die GHS Verordnung wurden 28 Gefahrenklassen eingeführt, welche nochmals in Kategorien unterteilt sind. Es ist eine differenziertere Sicht auf die Gefahrenstoffe möglich. Das Gefahrensymbol "Andreaskreuz" auf orangefarbenem Hintergrund ist aus dem Gefahrenkatalog entfernt worden. Drei neue Gefahrenpiktogramme für "Gase unter Druck", "Ausrufezeichen" und "Gesundheitsgefahr" wurden neu eingeführt.
Die Signalwörter "Gefahr" und "Achtung" werden auf den Etiketten nach der GHS Verordnung aufgeführt. Die R-Sätze als Gefahrenhinweise werden durch die H-Sätze (engl. hazard statement) ersetzt. Bei den Sicherheitshinweisen müssen die S-Sätze den P-Sätzen (engl. precautionary statement) weichen.
Die neue GHS Verordnung hat neue Einstufungen vorgenommen. Viele der gesundheitsschädlichen Stoffe und Gemische werden nun als giftig eingestuft. Stoffe, die vorher als "reizende" Gemische gekennzeichnet wurden, werden jetzt als "ätzend" bewertet. Nach der GHS werden entzündbare Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von 21°C bis einschließlich 60°C mit dem Gefahrenpiktogramm "Flamme" klassifiziert. Vorher gab es für diese Stoffe keine Gefahreneinstufung.
Die richtige Kennzeichnung gemäß GHS
Das Gefahrenetikett muss folgende Angaben gemäß der GHS Verordnung enthalten: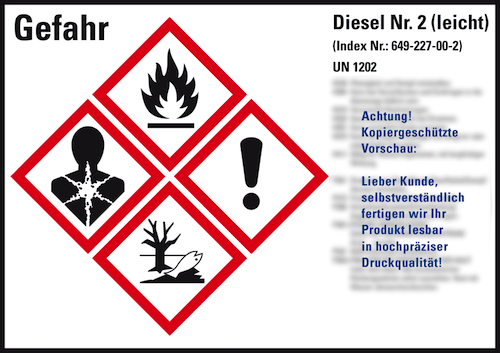
- Identifikations-Nr.
- Name des Stoffes
- Bezeichnung des Gemisches und die Inhaltsstoffe, die zur Einstufung bzgl. Gesundheitsgefahren beitragen
- Lieferanten-Anschrift und -Name
- Nennmenge
- Signalwort
- Piktogramm
- Gefahrenhinweise in Form von H-Sätzen (Angabe der Nummern nicht notwendig)
- Sicherheitshinweise durch P-Sätze (Angabe der Nummern nicht notwendig)
- Ergänzende Informationen wenn nötig
Die Gefahrenetiketten können in mehreren Sprachen verfasst werden wenn alle Angaben übersetzt werden. Gängig ist es die Sprache des Mitgliedsstaates zu verwenden, in dem der Stoff oder das Gemisch in Verkehr gebracht wurde.
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
Die DIN 67510 ist eine Norm, die sich mit der Photolumineszenz von Materialien beschäftigt. Genauer gesagt legt sie die Anforderungen und Prüfverfahren für phosphoreszierende (nachleuchtende) Materialien fest, die in verschiedenen Anwendungen eingesetzt werden, insbesondere im Bereich der Sicherheits- und Kennzeichnungstechnik. Die Norm spielt eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung von Sicherheit und Orientierung, insbesondere in Notfallsituationen, indem sie Standards für die Leuchteigenschaften von Materialien festlegt.
Die DIN 67510 ist in drei Teile untergliedert, von denen jeder spezifische Aspekte der Photolumineszenz behandelt:
Teil 1 Alles rund um die Vermessung lang nachleuchtender Materialien und Produkte beim Hersteller
Die DIN 67510-1 definiert auf Basis der Vermessung beim Hersteller verschiedene Leuchtklassen für lang nachleuchtende Materialien, eine besondere Bedeutung dieser Klassen ergeben sich hierbei für die Sicherheitskennzeichnung. Diese Leuchtklassen geben an, wie lange die Materialien nach einer definierten Belichtung durch eine Lichtquelle noch sichtbar leuchten. Klasse A und B, wie sie in der Norm definiert werden, sollten in der Sicherheitskennzeichnung mittlerweile keine Anwendung mehr finden!
Nach DIN 67510-1 sollten die Klasse und der 10 und 60 Minutenwert mcd/m² auf dem Produkt angegeben werden. Um die Klasse C und damit die Anforderungen der ASR zu erfüllen, muss dieser mind. 140 mcd/m² nach 10 Minuten und 20 mcd/m² nach 60 Minuten nach Vollanregung erreichen. Die Werte werden wie folgt dargestellt: 140 / 20, wobei höhere Werte stärkere lang nachleuchtende Eigenschaften beschreiben.
Lang nachleuchtende Sicherheitszeichen sollten mindestens der Klasse C entsprechen, da diese die Anforderung der gültigen technischen Regeln für Arbeitsstätten ASR1.3 und A2.3 erfüllt. Mit unseren PERMALIGHT® power Produkten sind Sie auf der sicheren Seite, da sie der expliziten Anforderungen zur Leuchtdichte der Klasse C entsprechen.
| Eigenschaft |
Zeit nach vollständiger Anregung |
PERMALIGHT® power |
|
|
 |
| Leuchtdichte nach vollständiger Anregung nach DIN 67510-1 |
nach 10 Minuten |
150 mcd/m |
| Leuchtdichte nach vollständiger Anregung nach DIN 67510-1 |
nach 60 Minuten |
22 mcd/m |
| Klassifizierung nach DIN 67510-1 |
|
Klasse C |
| Abklingdauer |
|
35 Stunden |
| Empfehlung für Sicherheitskennzeichnung |
|
Wird empfohlen |
| Einsatz |
|
PERMALIGHT® power-Produkte erfüllen die Vorgaben der 67510-1 Klasse C und sind bei Ausfall der Allgemeinbeleuchtung die geeignete Lösung um die Erkennbarkeit der notwendigen Rettungs- und Brandschutzzeichen zu gewährleisten. |
Teil 2 Messung von lang nachleuchtenden Produkten am Ort der Anwendung
Der zweite Teil der DIN (67510-2) konzentriert sich auf die Messung lang nachleuchtende Materialien am letztendlichen Ort der Anwendung, also beispielsweise in Bürogebäuden. Er definiert hierfür unter anderem spezifische Anforderungen für die Ausführung der Messung.
Was besagt die DIN 4066?
In dieser Norm sind Anforderungen an Hinweisschilder für die Feuerwehr und sonstige Brandschutzkräfte festgelegt. Ein wichtiger Bestandteil für Ihr Unternehmen, denn im Notfall können sich Feuerwehr und Helfer besser orientieren. Den genauen Wortlaut der DIN 4066 finden Sie beim Beuth-Verlag .
Unsere Topseller aus dem Sortiment Feuerwehrschilder:
Was sind Feuerwehrzeichen?
Zu den Feuerwehrzeichen gehören unter anderem Hinweisschilder für die Brandschutztür und die Feuerwehrzufahrt. Feuerwehrzeichen findet man außerdem auch an Toren, Fahrstühlen, Sprinkleranlagen sowie an Gasleitungen, um die Feuerwehr bei der Brandbekämpfung zu unterstützen und für eine schnelle Orientierung zu sorgen. Die Hinweis erfolgen dabei in Textform, sprich Feuerwehrzeichen enthalten somit keine Piktogramme. Die Optik und der Aufbau der Zeichen sind in der Norm DIN 4066 geregelt, welche eindeutige Vorgaben an die Kennzeichnung für die Feuerwehr enthält. Im Gegensatz zu den Brandschutzzeichen, welche auf Einrichtungen für die Mitarbeiter hinweisen, geben die Schilder für die Feuerwehr hauptsächlich Hinweise für die Feuerlöscheinheiten. Diese Hinweise helfen den Einsatzkräften im Brandfall, indem sie Orientierung bieten und somit die Hilfestellung erleichtern!
Laut DIN 4066 müssen die Schilder in einer Höhe von (möglichst) zwei Metern sicher befestigt und eindeutig erkennbar angebracht werden. Dabei darf der Abstand des Schildes von der jeweiligen Anlage nicht mehr als 10 Meter betragen. Zum Anbringen können Sie auf verschiedene Schilderträger, wie z.B. Schilderständer oder Rohrpfosten, zurückgreifen und aus verschiedenen Materialien (Folie, Aluminium, Kunststoff) für die Schilder wählen.
Das könnten Sie auch interessieren:
Stand: 11.2016
Wichtiger Hinweis für Ärzte, Krankenhäuser, Zahnärzte und Tierärzte
Freiverkäufliche Arzneimittel dürfen an Ärzte, Krankenhäuser, Zahnärzte und Tierärzte von uns als Händler nur mit einer entsprechenden Genehmigung verkauft werden. Auf diese Genehmigung haben wir als Unternehmen verzichtet, daher können wir Ihnen diese Produkte nicht anbieten und verkaufen.
Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen!
Händedesinfektion
Sterillium
Gültig für alle Artikel des Produktes HARTMANN Desinfektionsmittel Sterillium®
Artikelnummern: 60249, 60251, 60250, 37093, 37325,60248,37319, 37095
Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Duftstoffe, Patentblau V 85 %, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Sterillium soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO2 löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.
Stand: 28.04.2014
Sterillium classic pure
Gültig für unsere Artikel des Produktes: HARTMANN Handdesinfektionsmittel Sterillium® classic pure
Artikelnummern: 37108, 37321, 37104, 37320
Wirkstoffe: Propan-2-ol, Propan-1-ol, Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoffe: Propan-2-ol 45,0 g, Propan-1-ol 30,0 g, Mecetroniumetilsulfat 0,2 g. Sonstige Bestandteile: Glycerol 85 %, Tetradecan-1-ol, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen. Gegenanzeigen: Für die Desinfektion von Schleimhäuten nicht geeignet. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Überempfindlichkeit (Allergie) gegen einen der Wirkstoffe oder der sonstigen Bestandteile. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Die Händedesinfektion dient der gezielten Vermeidung einer Infektionsübertragung z. B. in der Krankenpflege. Sterillium classic pure soll nicht bei Neu- und Frühgeborenen angewendet werden. Die Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern soll erst nach ärztlicher Rücksprache erfolgen. Ein Kontakt der Lösung mit den Augen muss vermieden werden. Wenn die Augen mit der Lösung in Berührung gekommen sind, sind sie bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser zu spülen. Ein Umfüllen von einem Behältnis in ein anderes soll vermieden werden um eine Kontamination der Lösung zu vermeiden. Wenn Umfüllen unvermeidbar ist, darf es nur unter aseptischen Bedingungen (z. B. Benutzung von sterilen Behältnissen unter Laminar Air Flow) erfolgen. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Auch nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23 °C, entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO2 löschen.
Stand: 27.06.2012
Sterillium med
Gültig für unsere Artikel des Produktes HARTMANN Sterillium® med
Arikelnummern: 37274, 37273, 37275
Wirkstoff: Ethanol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 99 % 85,0 g, Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, 1-Propanol (Ph. Eur.), Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offener Wunden anwenden. Hinweis: Bei Kontakt der Lösung mit den Augen sollten die geöffneten Augen für einige Minuten mit fließendem Wasser gewaschen werden. Nicht bei Überempfindlichkeit (Allergie) gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile anwenden. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Nur äußerlich anwenden. Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen verursachen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten – nicht rauchen. Flammpunkt nach DIN 51755: ca. 16 °C, leichtentzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Im Brandfall mit Wasser, Löschpulver, Schaum oder CO2 löschen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.
Stand: 27.06.2012
Sterillium Virugard
Gültig für unsere Artikel des Produktes HARTMANN Desinfektionsmittel Sterillium® Virugard
Artikelnummern: 37109, 37316, 37260
Wirkstoff: Ethanol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 99 % 95,0 g. Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Glycerol, Tetradecan-1-ol, Benzin. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen oder offenen Wunden anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Nebenwirkungen: Selten treten leichte, diffuse Hautirritationen oder allergische Reaktionen auf. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Warnhinweise: Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flasche nach Gebrauch verschließen. Flammpunkt nach DIN 51755: 0 °C. Leicht entzündlich. Elektrostatische Aufladung vermeiden. Mit alkoholnassen Händen nicht berühren. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Nicht rauchen.
Stand 27.06.2012
Manusept basic
Gültig für unsere Artikel des Produktes HARTMANN Handdesinfektionsmittel Manusept®
Artikelnummern: 37100, 37099, 37101
Wirkstoff: Ethanol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Ethanol 99 % 80 g. Sonstige Bestandteile: Butan-2-on, Gereinigtes Wasser, Heptamethylnonan, Tetradecan-1-ol, (RS)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure, (RS)-5-Oxopyrrolidin-2-carbonsäure, Natriumsalz. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen und chirurgischen Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Manusept basic ist nicht zur Desinfektion großflächiger, offener Wunden geeignet. Nicht auf Schleimhäuten und in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Überempfindlichkeit gegen Inhaltsstoffe. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Manusept basic während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Leichte, diffuse Hautrötungen sind selten. Das Auftreten von Juckreiz, Spannungsgefühl und Schuppung (auch im Rahmen allergischer Kontaktekzeme) ist möglich. Warnhinweise: Nur äußerlich anwenden. Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen und Hauttrockenheit verursachen. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. Flammpunkt nach DIN 51755: 19,5 °C, leicht entzündlich. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit. Verdünnen mit viel Wasser. Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.
Stand: 28.04.2014
Sterillium Tissue
Gültig für unseren Artikel: 37261
Wirkstoffe: 2-Propanol (Ph. Eur.), 1-Propanol (Ph. Eur.), Mecetroniumetilsulfat. Zusammensetzung: 1 Feuchttuch aus Vlies enthält: Wirkstoffe: Propan-2-ol 1.341 mg, Propan-1-ol 894 mg, Mecetroniumetilsulfat 5,96 mg. Sonstige Bestandteile: Tetradecan-1-ol, Glycerol 85 %, Duftstoffe, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Zur hygienischen Händedesinfektion und zur Hautdesinfektion vor Injektionen und Punktionen auf talgdrüsenarmer Haut. Gegenanzeigen: Sterillium Tissue darf nicht angewendet werden, wenn eine Überempfindlichkeit (Allergie) gegen 2-Propanol (Ph. Eur.), 1-Propanol (Ph. Eur.), Mecetroniumetilsulfat oder einen der sonstigen Bestandteile besteht, in der unmittelbaren Nähe der Augen oder offener Wunden, bei Früh- und Neugeborenen, zur Desinfektion von Schleimhäuten. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann eine leichte Trockenheit oder Reizung der Haut auftreten. In solchen Fällen wird empfohlen, die allgemeine Hautpflege zu intensivieren. Allergische Reaktionen sind selten. Warnhinweise: Anwendung bei Säuglingen und Kleinkindern erst nach ärztlicher Rücksprache. Berührung mit den Augen vermeiden. Bei Berührung mit den Augen sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen. Elektrische Geräte erst verwenden, wenn das Mittel getrocknet ist. Von offenen Flammen fernhalten. Nicht in der Nähe von Zündquellen verwenden. Flammpunkt 23,5 °C, entzündlich. Im Brandfall mit Wasser, Feuerlöscher, Schaum oder CO2 löschen.
Stand: 27.6.2012
desderman® pure
Gültig für unsere Artikel des Produktes schülke Desinfektionsmittel desderman® pure
Artikelnummern: 37314, 37315, 37262
Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Arzneilich wirksame Bestandteile: 78,2 g Ethanol 96 %, 0,1 g Biphenyl-2-ol. Sonstige Bestandteile: Povidon 30, Isopropylmyristat (Ph.Eur.),(Hexadecyl/octadecyl) (2-ethylhexanoat), Sorbitol-Lösung 70 % (kristallisierend) (Ph.Eur.), 2-Propanol(Ph. Eur.), gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hygienische und chirurgische Händedesinfektion. Ethanol und Biphenyl-2-ol wirken gegen Bakterien (inkl. Mykobakterien), Pilze und viele Viren. Die Wirksamkeit von desderman® pure gegen Viren schließt behüllte Viren (Klassifizierung „begrenzt viruzid") und Rotaviren ein. Gegenanzeigen: Überempfindlichkeit gegenüber den arzneilich wirksamen Bestandteilen oder einem der sonstigen Bestandteile. Nicht auf Schleimhäuten anwenden. Nebenwirkungen: Gelegentlich kann es zu für alkoholische Händedesinfektionsmittel typischen Nebenwirkungen wie Hautirritationen (z.B. Rötung, Trockenheit) kommen. Meist klingen diese Missempfindungen trotz weiterer Anwendung bereits nach 8-10 Tagen wieder ab. Auch Kontaktallergien können auftreten. Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die hier nicht aufgeführt sind. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Nur äußerlich anwenden. Bei versehentlichem Augenkontakt mit desderman® pure sofort bei geöffnetem Lidspalt mehrere Min. mit viel Wasser spülen. Flammpunkt nach DIN 51755 16°C. Leicht entzündlich. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind unverzüglich Maßnahmen gegen Brand und Explosion zu treffen. Geeignete Maßnahmen sind z.B. das Aufnehmen verschütteter Flüssigkeit und Verdünnen mit Wasser, das Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen. Geprüft gegen Testviren BVDV (Surrogatviren für Hepatitis-C-Virus) und Vakziniavirus. Die Ergebnisse lassen nach aktuellem Kenntnisstand den Rückschluss auf die Wirksamkeit gegen andere behüllte Viren zu, z.B. Hepatitis B-Virus, HI-Virus.
Hautdesinfektion
Cutasept F
Gültig für unsere Artikel des Produktes HARTMANN Desinfektionsmittel Cutasept® F
Artikelnummern: 36774, 37092, 37103
Wirkstoff: Propan-2-ol. Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten: Wirkstoff: Propan-2-ol 63,0 g, entspricht 72 Vol.%. Sonstige Bestandteile: Benzalkoniumchlorid, Gereinigtes Wasser. Anwendungsgebiete: Hautdesinfektion vor Punktionen, Injektionen und operativen Eingriffen. Chirurgische und hygienische Händedesinfektion. Gegenanzeigen: Nicht in unmittelbarer Nähe der Augen anwenden. Unverträglichkeit gegenüber Inhaltsstoffen. Bei sachgemäßem Gebrauch kann Cutasept F während der Schwangerschaft und Stillzeit verwendet werden. Nebenwirkungen: Leichte, diffuse Hautreizungen sind häufig. Kontaktallergische Reaktionen können auftreten. Warnhinweise: Für die Behandlung von Säuglingen und Kleinkindern liegen keine ausreichenden Erfahrungen vor. Die Anwendung darf in diesen Fällen nur nach besonders strenger Indikationsstellung und unter ärztlicher Aufsicht erfolgen. Benzalkoniumchlorid kann Hautreizungen hervorrufen. Keine Hautbenetzung unter Blutleere-Manschetten. Bei Inzisionsfolien vollständige Auftrocknung abwarten. Erst nach Auftrocknung elektrische Geräte benutzen. Ansammlungen auf Patientenliegefläche vermeiden. Nicht in Kontakt mit offenen Flammen bringen. Von Zündquellen fernhalten. Bei bestimmungsgemäßer Verwendung des Präparates ist mit Brand- und Explosionsgefahren nicht zu rechnen. Nach Verschütten des Desinfektionsmittels sind folgende Maßnahmen zu treffen: Sofortiges Aufnehmen der Flüssigkeit, Verdünnen mit viel Wasser, Lüften des Raumes sowie das Beseitigen von Zündquellen. Flammpunkt nach DIN 51755: 21 °C. Entzündlich. Ein etwaiges Umfüllen darf nur unter aseptischen Bedingungen (Sterilbank) erfolgen.
Stand: 27.06.2012
Wund- und Schleimhaut-Desinfektion
octenisept® Wund-Desinfektion
(Gültig für unseren Artikel: 37277)
Arzneilich wirksame Bestandteile: Octenidinhydrochlorid, Phenoxyethanol (Ph. Eur.) Anwendungsgebiete: Zur wiederholten, zeitlich begrenzten unterstützenden antiseptischen Wundbehandlung. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung: Um möglichen Gewebeschädigungen vorzubeugen, darf das Präparat nicht unter Druck ins Gewebe eingebracht bzw. injiziert werden. Bei Wundkavitäten muss ein Abfluss jederzeit gewährleistet sein (z.B. Drainage, Lasche). octenisept® Wund-Desinfektion nicht in größeren Mengen verschlucken oder in den Blutkreislauf, z.B. durch versehentliche Injektion, gelangen lassen.

Der Leitgedanke der Straßenverkehrsordnung ist gegenseitige Rücksichtnahme!
Nach der Straßenverkehrsordnung werden die Regeln für sämtliche Teilnehmer im Straßenverkehr klassifiziert. Nutzen Sie diese Regeln auch für Ihr Betriebsgelände und lenken Sie alle Verkehrsteilnehmer optimal durch Ihren Betrieb. Den genauen Wortlaut der StVO halten wir zum Download für Sie bereit!
Bei Kroschke SIGN finden Sie eine große Auswahl an Verkehrsschildern gemäß der Straßenverkehrsordnung. Wählen Sie zwischen Park- und Halteverbotsschildern, Wegweisern, Geschwindigkeitsanzeigen und -begrenzungen, sowie Verkehrszeichen wie Verbotsschilder für Einfahrten. Mit nur einem Klick gelangen Sie zu unseren Schildern gemäß StVO.
StVO Grundregeln
Nach den Grundregeln der StVO Straßenverkehrsordnung erfordert die Teilnahme am Straßenverkehr eine gegenseitige Rücksichtnahme und dauernde Vorsicht gegenüber Ihren Mitmenschen. Jeder hat sich so zu verhalten, dass keinem anderen Verkehrsteilnehmer Schaden zugefügt wird, keiner gefährdet, belästigt oder behindert wird, wenn es nicht anders vermeidbar ist.
Halten und Parken gemäß der Straßenverkehrsordnung
Mit den Schildern von Kroschke SIGN kennzeichnen Sie Parkmöglichkeiten und Halteverbote eindeutig. Ein Fahrzeug gilt als geparkt, wenn man es verlässt oder für länger als 3 Minuten hält. In folgenden Situationen ist das Halten gemäß der StVO unzulässig:
- Auf Bahnübergängen
- Vor und in amtlich gekennzeichneten Feuerwehrzufahrten
- Auf Aus- & Einfädelungsstreifen
- In scharfen Kurven
- An unübersichtlichen, engen Straßenstellen
Das Parken ist in diesen Situation nicht gestattet:
- Vor Bordsteinabsenkungen
- Vor Ein- & Ausfahrten von Grundstücken
- Bei Verhinderung der Benutzung von gekennzeichneten Parkflächen
- Über Schachtdeckeln oder ähnlichem (Durch das Zeichen 315 oder eine Parkflächenmarkierung "Anlage 2 Nr. 74" ist das Parken auf Gehwegen erlaubt)
- Vor und hinter Einmündungen und Kreuzungen bis zu je 5,00 m von den Schnittpunkten der Fahrbahnkanten entfernt
Die Möglichkeit Kraftfahrzeuganhänger ohne Zugfahrzeug zwei Wochen lang zu parken, ist gegeben. Diese Zeit des Parkens darf nicht überschritten werden. Als Ausnahme gelten die entsprechend gekennzeichneten Parkplätze.
Der rechte Seitenstreifen, sowie die entlang der Fahrbahn angelegten Parkstreifen, wenn sie dazu ausreichend befestigt sind, dienen dem rechtmäßigen Parken. Auch zum Halten mit dem Fahrzeug ist die rechte Fahrbahnseite zu benutzen. Taxen ist es gestattet, bei ruhiger Verkehrslage, neben anderen Fahrzeugen, die am rechten Fahrbahnrand oder auf dem Seitenstreifen halten oder parken, Fahrgäste ein- bzw. aussteigen zu lassen. In Einbahnstraßen nach Zeichen 220 oder in Straßen mit rechts liegenden Schienen darf links gehalten und geparkt werden. Zu beachten ist, dass im Fahrraum von Schienenfahrzeugen nicht gehalten werden darf.
Sicherheitskennzeichen und Schilder der aktuellen Normen
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
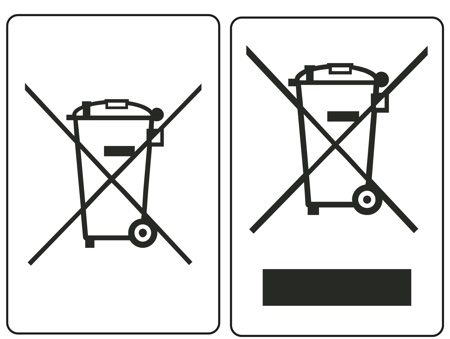
WEEE-Richtlinie 2002-96/EG
Die Waste Electrical Electronic Equipment-Richtlinie ist die EG-Richtlinie 2002/96/EG zur Reduktion der zunehmenden Menge an Elektronikschrott aus nicht mehr benutzten Elektro- und Elektronikgeräten. Diese Norm regelt die Rücknahme und das Recycling von Elektroaltgeräten durch eine erweiterte Herstellerverantwortung.
- Jeder Hersteller muss durch die Kennzeichnung des Geräts eindeutig zu identifizieren sein.
- Das Symbol für die getrennte Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten stellt eine durchgestrichene Abfalltonne auf Rädern dar.
- Es ist außerdem ein Hinweis auf dem Produkt anzubringen, dass das Gerät nach dem 13. August 2005 – in Deutschland nach dem 23. März 2006 in Verkehr gebracht wurde - entweder mittels des Herstellerdatums oder aber durch die Kennzeichnung des Balkens unter der durchkreuzten Abfalltonne.
Den genauen Wortlaut der WEEE-Richtlinie 2002/96/EG steht für Sie zum Download bereit.
Zu den Produktkennzeichen ➤
Ziele der WEEE-Richtlinie
Mit dem WEEE Gesetz sollen Abfälle von Elektro- und Elektronikgeräten vermieden werden. Es bezweckt die Wiederverwendung, die stoffliche Verwertung und weitere Formen der Verwertung solcher Abfälle, um die zu beseitigende Abfallmenge zu reduzieren und auch den Eintrag von Schadstoffen aus Elektro- und Elektronikgeräten in Abfällen zu verringern.
Anwendungsbereiche nach der WEEE-Richtlinie
Das Gesetz der WEEE-Richtlinie gilt für alle Elektro- und Elektronikgeräte, die unter die Kategorien der Haushaltsgeräte, der Geräte für Informations- und Telekommunikationstechnik sowie Unterhaltungstechnik, der Beleuchtungskörper, der elektrischen und elektronischen Werkzeuge (Ausnahme ortsfeste industrielle Großwerkzeuge), der Spielzeug und Fitnessgeräte, der Medizinprodukte (Ausnahme implantierte und infektiöse Produkte), der Überwachungs- und Kontrollinstrumente sowie der automatischen Ausgabegeräte fallen. Diese Geräte dürfen nicht Teil eines anderen Gerätes sein, welches nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes WEEE fällt.
Statten Sie sich mit unseren passenden WEEE-Kennzeichen aus:
Diese Kategorien könnten Sie auch interessieren:
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
Die im November 2013 überarbeitete und im April 2014 veröffentlichte TRGS 900 bringt eine Absenkung des Arbeitsplatzgrenzwertes (AGW) für die A-Staubfraktion von bisher 3 mg/m³ auf nun 1,25 mg/m³ mit sich. In den vergangenen Jahren wurde der AGW unter dem Aspekt des präventiven Gesundheitsschutzes immer weiter abgesenkt. So galt bis 2001 noch ein AGW von 6 mg/m³. Ziel ist es, chronische, partikelbedingte Entzündungsprozesse und pathologische Veränderungen in der Lunge zu vermeiden.
Von der Neuregelung unberührt bleiben Stäube, für die ohnehin geringere Grenzwerte als 1,25 mg/m³ festgelegt sind. Dies ist z.B. bei Schweißrauch bei manchen Schweißverfahren gemäß der TRGS 528 der Fall.
A-Staub, E-Staub?
Alle Teilchen, die durch Mund und Nase eingeatmet werden, bezeichnet man als einatembare Fraktion (E-Staub). In Abhängigkeit von ihrer Größe erreichen sie unterschiedliche Abschnitte der Atemwege. Während die in die Bronchien gelangenden Partikel relativ rasch wieder abgehustet werden, lagern sich die bis in die Aveolen* (A-Staub) gelangenden feinen Staubteilchen mit einem Durchmesser ≤ 5 µm über Monate oder Jahre an. Tückisch ist, dass sich nicht unmittelbar Krankheitssymptome zeigen, sondern sich über Jahrzehnte zu einer chronischen Erkrankung wie der sogenannten Staublunge entwickeln können. Staublungenerkrankungen gehören zu den häufigsten gesetzlich anerkannten, entschädigungspflichtigen Berufskrankheiten. Bereits seit 1929 werden sie in der Berufskrankheitenverordnung aufgeführt.
Was bedeutet der neue Grenzwert für die Praxis?
Von der Absenkung des allgemeinen Staubgrenzwertes sind mehrere Millionen Arbeitsplätze sind betroffen. Praktisch in allen Branchen und Industriezweigen gibt es Arbeitsplätze, die Stäuben ausgesetzt sind – sei es durch den Umgang mit staubenden Materialien oder durch bei der Verarbeitung entstehende Staubemissionen.
Es kann sein, dass jetzt erstmalig Atemschutz an Arbeitsplätzen einzusetzen ist, an denen bislang noch keine Pflicht zum Tragen von Atemschutzmasken bestand. Auch wird in vielen Bereichen, in denen bereits Atemschutz getragen wird, der Wechsel in eine höhere Schutzstufe notwendig. Die Tabellen verdeutlichen die Auswirkung der Änderungen:
| Schutzstufen der Atemschutzmasken und Partikelfilter |
FFP1 oder Halbmaske mit P1-Filter |
FFP2 oder Halbmaske mit P2-Filter |
FFP3 oder Halbmaske mit P3-Filter |
Vollmaske mit P1-Filter |
Vollmaske mit P2-Filter |
Vollmaske mit P3-Filter |
|
|
|
|
|
|
|
| Einsatzbereiche |
bis zum 4-fachen Grenzwert |
bis zum 10-fachen Grenzwert |
bis zum 30-fachen Grenzwert |
bis zum 4-fachen Grenzwert |
bis zum 15-fachen Grenzwert |
bis zum 400-fachen Grenzwert |
| Schutz gegen A-Stäube nach altem Grenzwert von 3 mg/m³ |
bis 12 mg/m³ |
bis 30 mg/m³ |
bis 90 mg/m³ |
bis 12 mg/m³ |
bis 45 mg/m³ |
bis 1200 mg/m³ |
| Schutz gegen A-Stäube nach neuem Grenzwert von 1,25 mg/m³ |
bis 5 mg/m³ |
bis 12,5 mg/m³ |
bis 37,5 mg/m³ |
bis 5 mg/m³ |
bis 18,75 mg/m³ |
bis 500 mg/m³ |
Verschiebung der Einsatzbereiche durch Absenkung des Allgemeinen Staubgrenzwertes
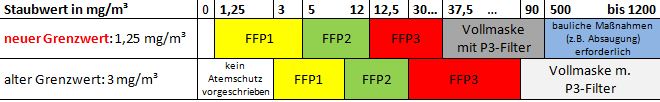
Beispiel: Die A-Staubbelastung am Arbeitsplatz beträgt 2,5 mg/m³
Bislang war kein Atemschutz notwendig. Heute muss eine FFP1-Maske (schützt bis zum 4fachen des Grenzwertes, d.h. 4 x 1,25 mg/m³ = 5 mg/m³ mg/m³) getragen werden.
Beispiel: Die A-Staubbelastung am Arbeitsplatz beträgt 20 mg/m³
Vorher genügte eine FFP2-Maske (schützt bis zum 10fachen des Grenzwertes), um den alten Grenzwert von 3,0 mg/m³ einzuhalten: 10 x 3 mg/m³ = 30 mg/m³
Heute kann die FFP2-Maske nur bis zu einer Staubbelastung von 12,5 mg/m³ eingesetzt werden: 10 x 1,25 mg/m³ = 12,5 mg/m³. Sie müssen jetzt also eine FFP3-Maske (schützt bis zum 30fahren des Grenzwertes, also 30 x 1,25 mg/m³ = 37,5 mg/m³) benutzen.
Beispiel: Die A-Staubbelastung am Arbeitsplatz beträgt 50 mg/m³
Vorher genügte eine FFP3-Maske (schützt bis zum 30fachen des Grenzwertes), um den alten Grenzwert von 3,0 mg/m³ einzuhalten: 30 x 3 mg/m³ = 90 mg/m³
Heute bieten sowohl eine FFP3-Maske, als auch eine Halbmaske mit P3-Filter (schützt ebenfalls nur bis zum 30fachen des Grenzwertes) keinen hinreichenden Schutz: 30 x 1,25 mg/m³ = 37,5 mg/m³. Sie müssen eine Vollmaske mit P3-Filter (schützt bis zum 400fachen des Grenzwertes, also 400 x 1,25 mg/m³ = 500 mg/m³) einsetzen.
Übergangsfristen beachten
Zwar räumt die TRGS 900 eine großzügige Übergangsfrist bis zum 31.12.2018 ein – diese ist jedoch an viele Bedingungen geknüpft. So muss unter anderem auf jeden Fall eine aktuelle Gefährdungsbeurteilung vorliegen, d.h. staubbelastete Arbeitsplätze sind erneut zu bewerten. Auch muss ein Maßnahmenkonzept zur Einhaltung des neuen Grenzwertes vorliegen. Selbstverständlich darf der Staubwert den alten Grenzwert von 3,0 mg nicht überschreiten. Außerdem muss der Arbeitgeber Atemschutz zur Verfügung stellen, der bei Expositionsspitzen zu tragen ist.
Schutzmaßnahmen einleiten
Neben der Einleitung technischer Schutzmaßnahmen, wie z.B. Absaugung an der Emissionsquelle oder gleichmäßiger Raumlüftung kommt der Auswahl und dem Einsatz des richtigen Atemschutzes besondere Priorität zu.
Wir empfehlen Ihnen, unbedingt Tragetests verschiedener Modelle durchzuführen und die Mitarbeiter bei der Auswahl einzubeziehen. Erfahrungsgemäß haben Atemschutzmasken mit Ventil eine höhere Trageakzeptanz, als einfache Masken ohne Ventil. Je komfortabler die Maske, desto leichter fällt das Atmen und damit auch das Arbeiten. Gern können Sie bei uns Muster anfordern.
Rufen Sie einfach an: +49 531 318-588 oder kontaktieren Sie uns per email: vertrieb@kroschke.com

Berufsgenossenschaftliche Information - Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten
Was ist die DGUV Information 208-016?
Die DGUV Information 208-016, ehemals BGI 694, ist eine berufsgenossenschaftliche Information zum Umgang mit Leitern und Tritten.
Wann müssen Leitern und Tritte geprüft werden?
Im Betrieb verwendete Leitern und Tritte müssen jährlich von einem Fachmann über- und geprüft werden (Sicht- und Funktionsprüfung). Hierzu sind Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen festzulegen. Die Zeitabstände zwischen den Prüfungen richten sich nach den gegebenen Betriebsverhältnissen, nach der Nutzungshäufigkeit, der Beanspruchung bei der Benutzung sowie der Häufigkeit und Schwere festgestellter Mängel bei vorangegangenen Prüfungen und Kontrollen.
Welche alten Regelungen ersetzt die DGUV Information 208-016?
Seit Anfang 2008 wird die BGV D 36 durch die "Handlungsanleitung für den Umgang mit Leitern und Tritten - BGI 694" ersetzt. Hier werden diverse Fragen zu Leiterbauarten einschließlich Zubehör sowie über die Benutzung und Prüfung von Leitern und Tritten ausführlich beantwortet. Grundlage der DGUV Information 208-016, ehemals BGI 694, sind die Regelungen des Arbeitsschutzgesetztes (ArbSchG), Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der Berufsgenossenschaften.
Ihre Checkliste zur Prüfung
Für die systematische Überprüfung von Leitern und Tritten gemäß DGUV Information 208-016 stellen wir Ihnen eine hilfreiche Checkliste zur freien Verfügung. Um die Erfassung und Prüfung aller Leitern und Tritte sicherzustellen, empfiehlt es sich, diese zu nummerieren und die Checkliste zu einem Kontrollbuch zusammenzufassen.
Passende Etiketten für Ihre Leitern
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
 Die DGUV 112-198, ehemals BGR 198, findet in allen Arbeitsbereichen Anwendung, in denen das Risiko eines Absturzes besteht. Der Unternehmer muss entsprechende Sicherheitsausrüstung bereit stellen. Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz sind Auffangsysteme zur Sicherung von Personen an einem Anschlagpunkt, und zwar in der Weise, dass ein Absturz entweder ganz verhindert oder die Person sicher aufgefangen wird. Dabei wird der Fallweg begrenzt und die auf den Körper wirkenden Stoßkräfte auf ein erträgliches Maß reduziert. Die DGUV 112-198 gibt anschauliche Beispiele zu verschiedenen Auffangsystemen, die bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung eingesetzt werden können. Der genaue Wortlaut der Berufsgenossenschaftlichen Regel steht für Sie hier zum Download bereit. Zu unseren Produkten der Absturzsicherung
Die DGUV 112-198, ehemals BGR 198, findet in allen Arbeitsbereichen Anwendung, in denen das Risiko eines Absturzes besteht. Der Unternehmer muss entsprechende Sicherheitsausrüstung bereit stellen. Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz sind Auffangsysteme zur Sicherung von Personen an einem Anschlagpunkt, und zwar in der Weise, dass ein Absturz entweder ganz verhindert oder die Person sicher aufgefangen wird. Dabei wird der Fallweg begrenzt und die auf den Körper wirkenden Stoßkräfte auf ein erträgliches Maß reduziert. Die DGUV 112-198 gibt anschauliche Beispiele zu verschiedenen Auffangsystemen, die bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung eingesetzt werden können. Der genaue Wortlaut der Berufsgenossenschaftlichen Regel steht für Sie hier zum Download bereit. Zu unseren Produkten der Absturzsicherung
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung

BGR 198- Einsatz von persönlichen Schutzausrüstungen gegen Absturz
In allen Arbeitsbereichen, in denen das Risiko eines Absturzes besteht, muss der Unternehmer entsprechende Sicherheitsausrüstung bereit stellen. Persönliche Schutzausrüstungen gegen Absturz sind Auffangsysteme zur Sicherung von Personen an einem Anschlagpunkt, und zwar in der Weise, dass ein Absturz entweder ganz verhindert oder die Person sicher aufgefangen wird. Dabei wird der Fallweg begrenzt und die auf den Körper wirkenden Stoßkräfte auf ein erträgliches Maß reduziert. Die BGR 198 gibt anschauliche Beispiele zu verschiedenen Auffangsystemen, die bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung eingesetzt werden können. Der genaue Wortlaut der Berufsgenossenschaftlichen Regel steht für Sie hier zum Download bereit. Mit der Veröffentlichung der neuen DGUV Regel 112-198 ist die BGR 198 unwirksam geworden.
Zu unseren Produkten der Absturzsicherung
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung

BGR 197- Benutzung von Hautschutz
Die Haut ist das größte Organ des Menschen und verdient besonderen Schutz.
Um arbeitsbedingte Hauterkrankungen zu verhüten, hat der Unternehmer gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz die Pflicht, alle Arbeitsplätze im Hinblick auf mögliche hautgefährdende Tätigkeiten zu untersuchen. Die in dieser BGR-Regel enthaltenen technischen Lösungen informieren über Gefährdungsmöglichkeiten beim Kontakt der Haut mit Arbeitsstoffen und über die Arten der beruflichen Hauterkrankungen und Möglichkeiten der Prävention. Sie ordnen typische Hautbelastungen bestimmten Branchen oder Berufsgruppen zu und geben Hinweise auf die Auswahl von geeigneten Hautschutzpräparaten, beschreiben das Zusammenwirken von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln und geben Hilfen für das Erstellen eines betriebsbezogenen Hautschutzplanes. Der genaue Wortlaut der BGR 197 steht für Sie hier zum Download bereit.
Zu unseren Hautschutz Produkten
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung

BGR 199- Benutzung von persönlichen Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen
In allen Arbeitsbereichen, in denen das Risiko eines Absturzes besteht, muss der Unternehmer entsprechende Sicherheitsausrüstung und Systeme zur Bergung bereit stellen. Persönliche Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen sind Bestandteile von Rettungssystemen, mit denen Personen aus einer Notlage durch Herausziehen, Auf- oder Abseilen gerettet werden können. Hierzu gehören beispielsweise: Rettungsgurte, Rettungsschlaufen, Rettungshubgeräte, Abseilgeräte, Verbindungsmittel, Verbindungselemente und Anschlageinrichtungen. Die BGR 199 gibt konkrete Anweisungen zur Anwendung, Aufbewahrung und Prüfung der persönlichen Schutzausrüstung. Der genaue Wortlaut der Berufsgenossenschaftlichen Regel steht für Sie hier zum Download bereit. Mit der Veröffentlichung der neuen DGUV Regel 112-199 ist die BGR 199 unwirksam geworden.
Zu unseren Produkten der Höhensicherung
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
 Die DGUV 112-192, ehemals BGR 192, findet Anwendung auf die Auswahl von Augen- und Gesichtsschutz zur Prävention von Unfällen am Arbeitsplatz. Beim Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz sind mechanische, optische, thermische, elektrische, biologische, chemische Gefährdungen in der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen. Die DGUV 112-192 gibt anschauliche Hinweise zur Auswahl des erforderlichen Augen- und Gesichtsschutzes, zu Bereitstellung, Nutzung, Wartungs-, Reparatur- und Ersatzmaßnahmen. Der Text beinhaltet eine detaillierte Check-Liste zur Einordnung vorliegender Gefährdungen und zur Auswahlhilfe des richtigen Fuß- und Knieschutzes. Der genaue Wortlaut der DGUV 112-192 steht hier für Sie zum Download bereit.
Zu unseren Augenschutz Produkten
Die DGUV 112-192, ehemals BGR 192, findet Anwendung auf die Auswahl von Augen- und Gesichtsschutz zur Prävention von Unfällen am Arbeitsplatz. Beim Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz sind mechanische, optische, thermische, elektrische, biologische, chemische Gefährdungen in der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen. Die DGUV 112-192 gibt anschauliche Hinweise zur Auswahl des erforderlichen Augen- und Gesichtsschutzes, zu Bereitstellung, Nutzung, Wartungs-, Reparatur- und Ersatzmaßnahmen. Der Text beinhaltet eine detaillierte Check-Liste zur Einordnung vorliegender Gefährdungen und zur Auswahlhilfe des richtigen Fuß- und Knieschutzes. Der genaue Wortlaut der DGUV 112-192 steht hier für Sie zum Download bereit.
Zu unseren Augenschutz Produkten
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
 Die DGUV 112-195, ehemals BGR 195, findet Anwendung auf die Auswahl und die Benutzung von Schutzhandschuhen zum Schutz gegen schädigende Einwirkungen mechanischer, thermischer und chemischer Art sowie gegen Schäden durch Mikroorganismen und ionisierende Strahlen. Sie beinhaltet eine detaillierte Checkliste zur Einordnung vorliegender Gefährdungen und zur Auswahlhilfe des richtigen Schutzhandschuhs. Der genaue Wortlaut der DGUV 112-195 steht hier für Sie zum Download bereit.
Zu den Schutzhandschuhen
Die DGUV 112-195, ehemals BGR 195, findet Anwendung auf die Auswahl und die Benutzung von Schutzhandschuhen zum Schutz gegen schädigende Einwirkungen mechanischer, thermischer und chemischer Art sowie gegen Schäden durch Mikroorganismen und ionisierende Strahlen. Sie beinhaltet eine detaillierte Checkliste zur Einordnung vorliegender Gefährdungen und zur Auswahlhilfe des richtigen Schutzhandschuhs. Der genaue Wortlaut der DGUV 112-195 steht hier für Sie zum Download bereit.
Zu den Schutzhandschuhen
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung

Die DGUV 112-194, ehemals BGR 194, beschreibt die erforderlichen Hörschutzmittel je nach Gefährdungsvorlage mit anschaulichen Beispielen und detaillierten Angaben der zulässigen Höchstwerte. In Arbeitsbereichen mit hoher Lärmexposition ist der Unternehmer verpflichtet, den Mitarbeitern geeigneten Hörschutz zur Verfügung zu stellen. Den genauen Wortlaut der DGUV 112-194 finden Sie hier zum Download .
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
Professioneller Gehörschutz
 Seit Januar 2011 ist die ASR A4.3 in Kraft. Mit den neuen Technischen Regeln für Arbeitsstätten wurden die Anforderungen an die Erste-Hilfe-Ausstattung in Betrieben überarbeitet und die gesetzlichen Pflichten für den Arbeitgeber deutlich formuliert. Die ASR A4.3 hat Gültigkeit für alle Betriebe, Verwaltungen und Bildungseinrichtungen.
Seit Januar 2011 ist die ASR A4.3 in Kraft. Mit den neuen Technischen Regeln für Arbeitsstätten wurden die Anforderungen an die Erste-Hilfe-Ausstattung in Betrieben überarbeitet und die gesetzlichen Pflichten für den Arbeitgeber deutlich formuliert. Die ASR A4.3 hat Gültigkeit für alle Betriebe, Verwaltungen und Bildungseinrichtungen.
Die ASR A4.3 konkretisiert die Anforderungen an Mittel und Einrichtungen zur Ersten Hilfe sowie an Erste-Hilfe-Räume in den Betrieben. Unter anderem legen sie konkret die Inhalte von Verbandkästen, die erforderliche Anzahl und deren Bereitstellung fest. Auch für das Inventar von Sanitätsräumen und die Bereitstellung medizinischer Hilfsgeräte, wie z.B. Defibrillatoren liefert die neue ASR A4.3 klare Empfehlungen.
Was bedeutet das für Ihren Betrieb?
Bei Einhaltung der ASR A 4.3 sind Sie auf der sicheren Seite: Sie erfüllen alle Anforderungen, die der Gesetzgeber für die Bereitstellung von Erste-Hilfe-Mitteln fordert und sind für den Notfall bestens vorbereitet. Prüfen Sie deshalb noch heute Ihre Erste-Hilfe-Ausstattung:
- Entsprechen die Inhalte Ihrer Verbandkästen der neuen ASR A 4.3?
- Steht die ausreichende Anzahl Verbandkästen für den Notfall bereit?
- Benötigt Ihr Betrieb einen Defibrillator?
Wir unterstützen Sie!
Haben Sie Fragen zur praktischen Umsetzung der ASR A4.3 und zur normgerechten Ausstattung Ihrer Ersten Hilfe?
Rufen Sie uns an - unser Team berät Sie gerne und kompetent: Tel.+49 531 318-588 oder nutzen Sie unseren Experten-Chat
Nutzen Sie unsere praktische Prüf- und Kontroll-Liste als Downdload.
Inhalt Verbandkästen und Übersicht Anzahl Koffer im Betrieb
Wie viele Verbandkästen benötigt Ihr Betrieb? Welche Verbandmaterialien gehören gemäß den neuen Bestimmungen ab sofort in Ihre Erste Hilfe Koffer und Verbandschränke?
Lesen Sie hier alles: Inhalt Erste Hilfe Koffer und Übersicht Anzahl Koffer vs. Betriebsgröße
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
 Die ASR A1.5 konkretisiert die Anforderungen der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung dieser Technischen Regel kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der Gesundheit für die Beschäftigten erreichen.
Aufgrund umfangreicher Änderungen und Ergänzungen wurde die ASR A1.5 im März 2022 neu gefasst; sie ersetzt die ASR A1.5/1,2 vom Februar 2013.
Die ASR A1.5 konkretisiert die Anforderungen der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung dieser Technischen Regel kann der Arbeitgeber davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Schutz der Gesundheit für die Beschäftigten erreichen.
Aufgrund umfangreicher Änderungen und Ergänzungen wurde die ASR A1.5 im März 2022 neu gefasst; sie ersetzt die ASR A1.5/1,2 vom Februar 2013.
Begriffsbestimmung
Eine Rutschgefahr liegt vor, wenn aufgrund einer zu geringen bzw. einer unmittelbaren Änderung der Rutschhemmung der Fußbodenoberfläche oder des Verrutschens eines Bodenbelages, die Möglichkeit des Ausrutschens von Beschäftigten oder das Wegrutschen von Fahrzeugen oder Einrichtungsgegenständen besteht. Rutschhemmung ist eine Eigenschaft der Fußbodenoberfläche, die das Ausrutschen wirksam verhindert.
Stolperstellen sind Änderungen der Oberfläche des Fußbodens, die die Gefahr von Stürzen hervorrufen, z.B. durch Höhenunterschiede von mehr als 4 mm oder Spalten von mehr als 20 mm an Übergängen zu Rampen oder Schrägen.
Die R-Gruppe ist ein Maßstab für den Grad der Rutschhemmung. Bodenbeläge mit der R-Gruppe R 9 genügen den geringsten und mit der R-Gruppe R 13 den höchsten Anforderungen.
Inhalte
Fußböden in Räumen dürfen keine Unebenheiten, Vertiefungen, Stolperstellen oder gefährliche Schrägen aufweisen. Sie müssen gegen Verrutschen bzw. Kippen gesichert, tragfähig, trittsicher und rutschhemmend sein.
In Bereichen, die durchgehend begangen werden müssen, dürfen sich die Fußbodenoberflächen hinsichtlich ihrer Rutschhemmung nicht so voneinander unterscheiden, dass es zu Stolper- und Rutschgefahren kommen kann. Dies kann gegeben sein, wenn sich angrenzende Oberflächen hinsichtlich der Rutschhemmung:
-
um mehr als eine R-Gruppe unterscheiden
-
um mehr als zwei R-Gruppen unterscheiden, wenn der Übergang zu einer anderen Rutschhemmung deutlich erkennbar oder zu erwarten ist (z.B. bei Türdurchgängen oder -durchfahrten)
-
Bestehen aufgrund unterschiedlicher Rutschhemmungen Stolper- oder Rutschgefahren, sind geeignete Maßnahmen zu treffen, wie Übergangsbereiche, die in Laufrichtung mindestens 1,5 m lang sind.
Fußbodenoberflächen müssen unter Berücksichtigung der Art der Nutzung sowie der zu erwartenden gleitfördernden Stoffe (z. B. Wasser, Fett, Öl, Staub) eine sichere Benutzung ermöglichen. Rutschgefahren können sich beispielsweise durch Witterungseinflüsse, Nässe, Verunreinigungen oder Abnutzung der Fußbodenoberfläche ergeben. Rutschgefahren sind durch entsprechende Schutzmaßnahmen zu vermeiden. Als Schutzmaßnahmen kommen insbesondere geeignete Fußbodenbeläge infrage. Gebäudeeingänge sind so einzurichten, dass der Eintrag von Schmutz und Nässe nicht zu Rutschgefahren führt. Dies kann durch Sauberlaufzonen in Form von Schutz- und Feuchtigkeitsaufnehmern erreicht werden.
Fußbodenstellen, an denen sich die Gefahr des Stolperns oder Ausrutschens technisch nicht vermeiden lässt, z. B. wenn die erforderliche Rutschhemmung kurzzeitig herabgesetzt ist und sich die Ursachen hierfür nicht unverzüglich beseitigen lassen, wie nach einer Feuchtreinigung, sind entsprechend der ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ zu kennzeichnen. Hierzu haben sich Warnaufsteller bewährt. Erforderlichenfalls ist der betreffende Bereich zusätzlich abzusperren.
 Die Rutschsicherheit wird in Deutschland gemäß DIN 51130 geregelt. Die Rutschhemmung wird auf einer schiefen Ebene mit einem standardisierten Schuh und Gleitmittel gemessen. So werden die Rutschhemmungsklassen R9 (geringste Rutschhemmung) bis R13 (höchste Rutschhemmung) bestimmt.
Zu den Antirutschbelägen und -profilen
Die Rutschsicherheit wird in Deutschland gemäß DIN 51130 geregelt. Die Rutschhemmung wird auf einer schiefen Ebene mit einem standardisierten Schuh und Gleitmittel gemessen. So werden die Rutschhemmungsklassen R9 (geringste Rutschhemmung) bis R13 (höchste Rutschhemmung) bestimmt.
Zu den Antirutschbelägen und -profilen
Welche Rutschhemmung Ihre Fußböden aufweisen sollen, hängt von der Art der Arbeiten und der zu erwartenden Rutschgefahr ab. Orientierung bietet hier der Anhang 2 „Anforderungen an die Rutschhemmung von Fußböden“ der ASR A1.5.
Wir unterstützen Sie!
Haben Sie Fragen zur ASR A1.5/1,2 und zur Rutschhemmung? Rufen Sie uns an - unser Mitarbeiter-Team berät Sie gerne und kompetent: Tel.+49 0531 318-588
Weitere umfassende Informationen und Praxistipps zu Gesetze und Normen liefert Ihnen der Kroschke SIGN Blog in der Kategorie "Normen und Vorschriften" .
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
 Diese Kennzeichnung gilt für Rohrleitungen mit Kältemittel, Kühlmittel und Kälteträger, die nicht innerhalb eines geschlossenen Bausatzes verlegt sind. Sie dienen der einfachen Identifikation von Leitungen und sorgen so für schnelle und sachgerechte Instandsetzung der Anlage und wirksame Brandbekämpfung im Ernstfall. Den genauen Wortlaut der DIN 2405 finden Sie beim Beuth-Verlag .
Zu den Rohrleitungskennzeichen
Diese Kennzeichnung gilt für Rohrleitungen mit Kältemittel, Kühlmittel und Kälteträger, die nicht innerhalb eines geschlossenen Bausatzes verlegt sind. Sie dienen der einfachen Identifikation von Leitungen und sorgen so für schnelle und sachgerechte Instandsetzung der Anlage und wirksame Brandbekämpfung im Ernstfall. Den genauen Wortlaut der DIN 2405 finden Sie beim Beuth-Verlag .
Zu den Rohrleitungskennzeichen
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
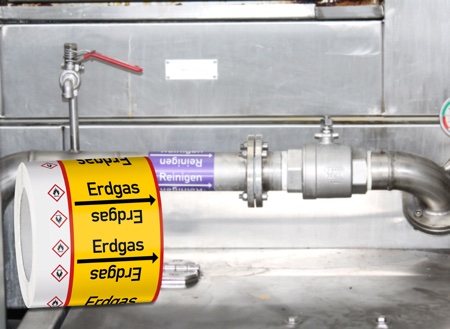
Rohrkennzeichnung nach aktueller Vorschrift
Die DIN 2403:2018-10 regelt die Kennzeichnung nicht erdverlegter Rohrleitungen nach dem Durchflussstoff. Diese Durchflussstoffe wurden nach allgemeinen Eigenschaften in 10 Gruppen eingeteilt und farblich codiert. Eine deutliche Kennzeichnung ist in Notsituationen, im Brandfall oder bei Unfällen und auch bei Wartungs- und Reparaturarbeiten wichtig, um Unfälle und gesundheitliche Schäden zu vermeiden. Durch die farbliche Kennzeichnung wird deutlich, mit welchen Gefahren zu rechnen ist. Die DIN 2403 gibt die Durchflussstoffe, die nach dem Chemikaliengesetz als Gefahrstoffe eingestuft werden, mit Gefahrensymbolen gemäß CLP/GHS zu kennzeichnen vor.
Des weiteren gibt sie vor, bei radioaktiven Durchflussstoffen zusätzlich ein Warnzeichen anzubringen. Den genauen Wortlaut der DIN 2403 finden Sie beim Beuth-Verlag. Noch nähere Informationen zur Aktualisierung der DIN 2403 im Oktober 2018 finden Sie in unserem Blogbeitrag: Rohrleitungen richtig kennzeichnen - Aktualisierung der DIN 2403
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
Wichtige Information zur DIN 4844
Die DIN 4844 enthielt bis zur Veröffentlichung der neuen DIN EN ISO 7010 im Oktober 2012 die relevanten Sicherheitskennzeichen für den Arbeitsschutz. Es handelt sich jetzt nur noch um eine Restnorm mit Zeichen, die nicht in der DIN EN ISO 7010 enthalten sind, unter anderem Piktos wie "Zutritt für Unbefugte verboten" & "Notausstieg". Die alten Bestimmungen der DIN 4844 wurden somit für alle zukünfigen Sicherheitskennzeichen durch die international gültige DIN EN ISO 7010 ersetzt.
DIN TR 4844-4
Dieser Teil der Norm informiert über die korrekte Anwendung von Sicherheitskennzeichnung, schauen Sie für weitere Informationen in unseren Blogbeitrag "Gut gemeint ist nicht immer gut gemacht - Sicherheitskennzeichen richtig anwenden"
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
DIN 4844 relevante Produkte und Artikel
Seit Juli 2020 ersetzt die DIN TR 4844-4 Grafische Symbole – Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen – Teil 4: Leitfaden zur Anwendung von Sicherheitskennzeichnung den Fachbericht DIN SPEC 4844-4. Das „TR“ steht hierbei für „Technischer Report“.
In der neuen DIN TR 4844-4 finden Sie Informationen rund um Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen – von der richtigen Kennzeichnung, über die Anwendung bis hin zur korrekten Anbringung. Aufgeführt werden die wichtigsten weiterführenden Inhalte welche sich beispielsweise auch so nicht in der ASR A1.3 wiederfinden.
Anbringung von Sicherheitszeichen
Bei der Anbringung von beispielsweise Verbots- und Warnzeichen müssen Sie beachten, in welcher Richtung der Querstrich verläuft und dass das Schild nicht kopfüber hängt.
Beispiel Verbotszeichen:

Beispiel Warnzeichen:

Anwendung von Zusatzzeichen
Zusatzzeichen helfen Sicherheitsaussagen zu konkretisieren, wenn diese durch das gewählte Gebots-, Warn- oder Verbotszeichen nicht deutlich werden. Hierfür gibt die DIN TR 4484-4 an, dass in erster Linie Zusatzzeichen symbolischer Art verwendet werden sollten und ein ergänzender Informationstext optional hinzugefügt werden kann.
Bei der Kombination der Sicherheitszeichen sollten jedoch folgende Kombinationen vermieden werden:
-
Verbotszeichen + Zusatzzeichen mit Warn- oder Gebotsaussage
-
Gebotszeichen + Zusatzzeichen mit Warn- oder Verbotsaussage
-
Warnzeichen + Zusatzzeichen mit Gebots- oder Verbotsaussage
Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass die DIN TR 4484-4 aussagt, dass ein Zusatzzeichen weder eine Sicherheitsaussage verändern, noch die Sicherheitsaussage eines anderen Sicherheitszeichens verwendet werden darf.
Die richtige Fluchtwegkennzeichnung
In diesem Abschnitt sind in der DIN TR 4484-4 einige Passagen wiederzufinden, die in umformulierter Form von der ASR A1.3 übernommen wurden (z.B. dauerhafte Kennzeichnung von Fluchtwegen). An einigen Stellen werden die übernommenen Aussagen zusätzlich konkretisiert.
Außerdem werden die Pfeilrichtungen gemäß DIN ISO 16069 aus dem Jahr 2019 aufgegriffen und die Richtungsbeschreibung des Richtungspfeils „nach oben“ noch einmal zementiert. Zu der Kombination von Rettungszeichen und Richtungspfeilen wird empfohlen, auf die Kombination der Rettungszeichen ISO 7010-E001“Notausgang links“ und -E002 „Notausgang rechts“ mit den klassischen Richtungsangaben Typ D nach DIN ISO 3864-3 zurückzugreifen. Konkretisiert zu sehen, ist dieses in der DIN ISO 16069:2019 Bild 1, Spalte 1 und 2.

 Nachdem im Juli 2020 auch das Zeichen für die „Fluchtwegkennzeichnung für nicht gehfähige bzw. gehbeeinträchtigte Personen“ in die DIN EN ISO 7010 übernommen worden ist, konkretisiert die DIN TR 4844-4 nun auch dessen Anwendung:
Nachdem im Juli 2020 auch das Zeichen für die „Fluchtwegkennzeichnung für nicht gehfähige bzw. gehbeeinträchtigte Personen“ in die DIN EN ISO 7010 übernommen worden ist, konkretisiert die DIN TR 4844-4 nun auch dessen Anwendung:
Fluchtwege, die für nicht gehfähige bzw. gehbeeinträchtigte Personen geeignet sind, sollten immer zusätzlich mit dem entsprechenden Sicherheitszeichen gemäß DIN ISO 7010 gekennzeichnet werden. Zusätzlich sollte auch hier ein Richtungspfeil verwendet werden, um hier die Richtung des Fluchtweges zu verdeutlichen. Insbesondere an Fluchtwegen, die speziell für nicht gehfähige bzw. gehbeeinträchtigte Personen installiert wurden (bspw. Rampen), ist eine spezielle Kennzeichnung erforderlich.
Die Kennzeichnung von Fluchtwegen für gehbeeinträchtigte oder gehbehinderte Personen ist jedoch keine eigenständige Fluchtwegkennzeichnung. Sie erfolgt immer ergänzend.
Montagehöhe von Fluchtwegkennzeichen – Hinweise zur Anbringungshöhe
Bei der Montage von Fluchtwegkennzeichen gibt es einiges zu beachten – unter anderem die Anbringungshöhe. Um hier eine Einheitlichkeit zu schaffen, finden Sie in der DIN TR 4484-4 eine genauere Definition dazu:
- Über Türen, offenen Flüren und Räumen: Anbringung mittig über dem Durchgang in einer Höhe von 2 bis 2,5 Metern.
Wichtig ist eine freie Sicht auf das Sicherheitszeichen
- Rettungszeichen an den Wänden, die parallel zum Fluchtweg verlaufen, sollten in einer Höhe von 1,8 bis 2 Metern angebracht werden.
- Winkel und Fahnenschilder sind auf einer Höhe von 2,5 Metern anzubringen
- Fluchtwegkennzeichnung, die auf einer Höhe von 2,5 Metern angebracht werden, sollten aufgrund ihre Aufmerksamkeitsgrades deutlich größer ausfallen.
- Innerhalb eines Objektes sollten Fluchtwegkennzeichen möglichst alle auf gleicher Höhe angebracht werden.
- Fluchtwegkennzeichen für nicht gehfähige bzw. gehbeeinträchtigte Personen sollten grundsätzlich auf einer Höhe von 1,2 bis 1,4 Metern angebracht werden.
Die Anbringungshöhe wird gemessen: vom Boden bis zur Unterkante des Rettungszeichens. Bei den angegeben Anbringungshöhen muss zudem sichergestellt werden, dass sich die Fluchtwegkennzeichnung im unmittelbaren Blickfeld befindet.
Kennzeichnung von Sammelstellen
Hier wird in einem Leitfaden die Kennzeichnung von Sammelstellen eingehender erläutert und von einer zu allen Seiten ausgerichteten und hochmontierten Kennzeichnung gesprochen. Lesen Sie hierzu unseren Blogbeitrag XY-
Neue Richtungspfeile für Erste-Hilfe- und Brandschutzeinrichtungen
Für die genannten Einrichtungen wurden mit der DIN TR 4484-4 neue Richtungspfeile eingeführt. Für Fluchtwege werden weiterhin die klassischen Richtungspfeile gemäß DIN ISO 3864-3 verwendet. Die neuen Pfeile nach DIN TR 4484-4 sollen einen Verwechslung mit den in der ASR A1.3 aufgeführten klassischen Richtungspfeile auf Fluchtwegen verringern.
Flucht- und Rettungspläne
In der DIN TR 4484-4 erhalten Sie neben Hinweisen zur Anbringung und der Darstellung auch konkrete Angaben zu den verschiedenen Maßstäben von Flucht- und Rettungsplänen. Gemäß DIN ISO 23601:2020-12 ist festgelegt, dass sich die Größe des Planes an der Größe der baulichen Anlage orientiert. Unterschieden wird hierbei in kleine, mittlere und große bauliche Anlagen.
A3 Flucht- und Rettungspläne
M 1 : 100 Gebäudegröße oder -ausschnitt ca. 15 x 30 m, kleine bauliche Anlage
M 1 : 250 Gebäudegröße oder -ausschnitt ca. 40 x 70 m, mittlere bauliche Anlage
A2 Flucht- und Rettungspläne
M 1 :100 Gebäudegröße oder -ausschnitt ca. 25 x 45 m, mittlere bauliche Anlage
M 1 : 250 Gebäudegröße oder -ausschnitt ca. 65 x 100 m, große bauliche Anlage
RoHS - Richtlinie 2002-95/EG
Die EG-Richtlinie 2002/95/EG - RoHS (engl. Restriction of the use of certain hazardous substances) zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Ab dem 01.07.2006 verbietet die Richtlinie den Einsatz von Blei, Quecksilber, Cadmium, Chrom sowie die Flammhemmer PBB und PBDE in den meisten Elektro- und elektronischen Geräten.
Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten) kurz ElektroG, wurde am 23. März 2005 verkündet (BGBl. I S. 762 f.) und trat am 24. März 2005 in Kraft. Das Gesetz setzt die EU- Regelungen: RoHS und WEEE in deutsches Recht um.
Der genaue Wortlaut der RoHS - Richtlinie 2002/95/EG steht für Sie zum Download (Amtsblatt der Europäischen Union) bereit.
Zu den Produktkennzeichen ➤
Ziel der RoHS - Richtlinie 2002-95/EG
Ziel der RoHS ist es, Bestandteile aus dem Elektroschrott zu verbannen, die problematisch einzustufen sind. Bei elektronischen Bauteilen sollten nur unverbleite Lötungen eingesetzt werden und umweltschädigende Flammhemmer in Kabelisolationen dürfen nicht verwendet werden. Auch die verwendeten elektrischen Bauelemente und das Zubehör müssen frei von problematischen Stoffen sein. Besonders Unternehmen die Geräte innerhalb der EU vertreiben oder sie importieren, welche von der neuen EU-Richtlinie 2002/95/EG RoHS betroffen sind, haben auf die Einhaltung der Vorschriften zu achten.
RoHS - Ausnahmen
Für bestimmte Gerätegruppen, Bauteile, Werkstoffe und Anwendungen gibt es auch Ausnahmen bei der festgelegten EU-Richtlinie RoHS. Die Ausnahmeregelungen sind im Artikel 4, Anhang III und IV der RoHS Richtlinie geregelt und festgehalten. Durch einen Antrag bei der EU-Kommission können die befristeten Ausnahmen verlängert oder verändert werden. Einige interessante Ausnahmen sind im Folgenden aufgeführt:
- Blei in Starterbatterien für Kraftfahrzeuge
- Blei in hochschmelzenden Loten
- Korrosionsschutzmittel (Kohlenstoffstahl-Kühlsystem) in Absorptionskühlschränken: Sechswertiges Chrom
- Blei in Bleibronze-Lagerbuchsen und -schalen
- Blei in Einpresssteckverbindern mit flexibler Zone
- Kompaktleuchtstofflampen mit Quecksilber (Höchstmenge 5 mg je Lampe)
- Blei im Glas von Kathodenstahlröhren, Leuchtstoffröhren und elektronischen Bauteilen
- Legierungselement Blei: Stahl (Anteil von bis zu 0,35 Gewichtsprozent), Aluminium (Anteil von bis zu 0,4 Gewichtsprozent), Kupferlegierungen (Anteil von bis zu 4 Gewichtsprozent)
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
GefahrStoffV 2010
Die Gefahrstoffverordnung (GefahrStoffV 2010) regelt die Einstufung gefährlicher Stoffe sowie deren Kennzeichnung und Verpackungsart. Sie hilft Gefahren erkennbar zu machen, sie abzuwenden und vorzubeugen. Gefahrstoffe sind chemische Stoffe oder Zubereitungen (Stoffgemische), die in der EU harmonisiert nach ihrem Gefährdungspotential eingestuft werden. Die Gefährlichkeit eines Stoffes oder einer Zubereitung wird durch Gefahrensymbole (auch Gefahrenkennzeichen genannt) angegeben.
Ausführliche und aktuelle Informationen zum Thema "Gefahrstoffe" finden Sie auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).
- Einfache Maßnahmenkonzepte
- Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)
- Risikobewertung und Stoff-Informationen
Die Gefahrstoffverordung wurde durch die GHS/CLP - Verordnung abgelöst.
Zu den Gefahrstoffetiketten nach GefahrStoffV 2010
Hier finden Sie Informationen zur aktuellen GHS/CLP Verordnung 2015
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
 Die Haut ist das größte Organ des Menschen und verdient besonderen Schutz. Um arbeitsbedingte Hauterkrankungen zu verhüten, hat der Unternehmer gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz die Pflicht, alle Arbeitsplätze im Hinblick auf mögliche hautgefährdende Tätigkeiten zu untersuchen. Die in dieser DGUV-Information enthaltenen technischen Lösungen informieren über Gefährdungsmöglichkeiten beim Kontakt der Haut mit Arbeitsstoffen und über die Arten der beruflichen Hauterkrankungen und Möglichkeiten der Prävention. Sie ordnen typische Hautbelastungen bestimmten Branchen oder Berufsgruppen zu und geben Hinweise auf die Auswahl von geeigneten Hautschutzpräparaten, beschreiben das Zusammenwirken von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln und geben Hilfen für das Erstellen eines betriebsbezogenen Hautschutzplanes. Der genaue Wortlaut der DGUV-Information 212-017 steht für Sie hier zum Download bereit.
Zu unseren Hautschutz Produkten
Die Haut ist das größte Organ des Menschen und verdient besonderen Schutz. Um arbeitsbedingte Hauterkrankungen zu verhüten, hat der Unternehmer gemäß § 5 Arbeitsschutzgesetz die Pflicht, alle Arbeitsplätze im Hinblick auf mögliche hautgefährdende Tätigkeiten zu untersuchen. Die in dieser DGUV-Information enthaltenen technischen Lösungen informieren über Gefährdungsmöglichkeiten beim Kontakt der Haut mit Arbeitsstoffen und über die Arten der beruflichen Hauterkrankungen und Möglichkeiten der Prävention. Sie ordnen typische Hautbelastungen bestimmten Branchen oder Berufsgruppen zu und geben Hinweise auf die Auswahl von geeigneten Hautschutzpräparaten, beschreiben das Zusammenwirken von Hautschutz-, Hautreinigungs- und Hautpflegemitteln und geben Hilfen für das Erstellen eines betriebsbezogenen Hautschutzplanes. Der genaue Wortlaut der DGUV-Information 212-017 steht für Sie hier zum Download bereit.
Zu unseren Hautschutz Produkten
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
 Die BGR-Regel bestimmt Kriterien zur Auswahl und Benutzung von Handschuhen, Stulpen und Armschützern zum Schutz vor Schnitt- oder Stechverletzungen im Betrieb.
"Bestehen auf Grund der Gefährdungsermittlung Gefährdungen des Körpers, der Hände und/oder Arme der Versicherten durch Stiche oder Schnitte und ist es nicht möglich, diese vorrangig durch technische oder organisatorische Maßnahmen zu beseitigen, müssen den gefährdeten Personen nach § 3 Arbeitsschutzgesetz durch den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin geeignete persönliche Schutzausrüstungen in Form von Stechschutzbekleidungen, Stechschutzhandschuhen, Armschützern, Stulpen oder Kombinationen dieser Schutzausrüstungen zur Verfügung gestellt werden." (BGR 202, 3.1)
Der genaue Wortlaut der Berufsgenossenschaftlichen Regel steht für Sie hier zum Download bereit. Zu unseren Schnitt- und Stichschutzhandschuhen
Die BGR-Regel bestimmt Kriterien zur Auswahl und Benutzung von Handschuhen, Stulpen und Armschützern zum Schutz vor Schnitt- oder Stechverletzungen im Betrieb.
"Bestehen auf Grund der Gefährdungsermittlung Gefährdungen des Körpers, der Hände und/oder Arme der Versicherten durch Stiche oder Schnitte und ist es nicht möglich, diese vorrangig durch technische oder organisatorische Maßnahmen zu beseitigen, müssen den gefährdeten Personen nach § 3 Arbeitsschutzgesetz durch den Arbeitgeber oder die Arbeitgeberin geeignete persönliche Schutzausrüstungen in Form von Stechschutzbekleidungen, Stechschutzhandschuhen, Armschützern, Stulpen oder Kombinationen dieser Schutzausrüstungen zur Verfügung gestellt werden." (BGR 202, 3.1)
Der genaue Wortlaut der Berufsgenossenschaftlichen Regel steht für Sie hier zum Download bereit. Zu unseren Schnitt- und Stichschutzhandschuhen
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
Die Bundesregierung hat die Neuverfassung der BetrSichV am 07.01.2015 beschlossen. Seit dem 01.06.2015 ist die Verordnung rechtswirksam und bringt einige verpflichtende Änderungen mit sich. Mit diesen Infoseiten über die neue BetrSichV wollen wir Sie bei der Umstellung unterstützen.
1. Was sind die Aufgaben der BetrSichV?
Die BetrSichV enthält Arbeitsschutzanforderungen für die Benutzung von Arbeitsmitteln und für den Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen im Sinne des Arbeitsschutzes. Es handelt sich dabei um die deutsche Umsetzung der Arbeitsmittelrichtlinie 89/655/EWG, später 2009/104/EG.
Eine regelmäßige Prüfung von Maschinen gewährleistet den einwandfreien Zustand und die fehlerfreie Funktion der Anlagen.
2. Profitiere ich von den Prüfungen nach der BetrSichV?
Hier ein klares JA! Denn, führen Sie Prüfungen nach der neuen BetrSichV durch, halten Sie sich nicht nur an die Richtlinien des Gesetzgebers, sondern sichern sich von höchster Instanz rechtlich ab. Zudem haben Sie zu jedem geprüften Objekt eine gerichtsfeste Dokumentation zur Hand. Diese dient Ihnen als anerkannter Nachweis, auch bei Unfällen oder Personenschäden.
Das Wichtigste: Sie reduzieren Ausfallquoten und die Prüfzyklen!
3. Welche Ziele verfolgt die neue BetrSichV?
Ein verbesserter Arbeitsschutz beim Umgang mit Arbeitsmitteln
Ein optimaler Schutz Dritter im Betrieb durch Aufnahme überwachungsbedürftigen Anlagen in die Gefährdungsbeurteilung – einheitliche Anforderungen für alle Arbeitsmittel und Anlagen sind somit verbindlich die Vereinfachung der Anwendung von Arbeitsschutzregelungen bei Arbeitsmitteln insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen die Verbesserung des Arbeitsschutzes allgemein.
4. Dokumentation der Prüfungen
Das Ergebnis zu dokumentieren und mindestens bis zur nächsten Prüfung aufzubewahren ist Aufgabe des Arbeitgebers. Die Dokumentation kann seit dem 01.06.2015 „auch in elektronischer Form aufbewahrt“, sprich digital abgespeichert werden.
Die wichtigsten Änderungen im Überblick
- nicht mehr der Betreiber, sondern der Arbeitgeber ist unmittelbar für die Betriebssicherheit von Arbeitsmitteln und die Einhaltung der Prüfpflichten verantwortlich
- eine Gefährdungsbeurteilung muss bei überwachungsbedürftigen Anlagen, bei denen ausschließlich Dritte gefährdet sind, durchgeführt werden
- laut § 14 Abschnitt 1 müssen vor jeder erstmaligen Benutzung aller Arbeitsmittel, deren Sicherheit von den Montagebedienungen abhängt, von einer befähigten Person geprüft werden
- konzeptionelle und strukturelle Angleichung an andere moderne Arbeitsschutzverordnungen (insbesondere Gefahrstoffverordnung)
- enthält besondere Vorgaben zur alters- und altersgerechten Gestaltung
- berücksichtigt ergonomische und psychische Belastungen
- klare Trennung zwischen Pflichten der Hersteller und der Arbeitgeber als Verwender von Arbeitsmitteln
- die Arbeitsmittel müssen hinsichtlich Sicherheit aber auch Gesundheitsschutz dem Binnenmarktrecht entsprechen
- hinfällig ist die Unterscheidung zwischen „Änderungen“ und „wesentlichen Veränderungen“
- Die Gefährdungsbeurteilung und die Festlegung von Schutzmaßnahmen zum Explosionsschutz erfolgen nach der Gefahrstoffverordnung
- Für Aufzüge wird verpflichtend eine Prüfplakette eingeführt
- wenn Arbeitsmittel gleichzeitig als überwachungsbedürftige Anlage gelten entfällt die Doppelprüfung
- Die Anforderungen an Arbeitsmittel und Anlagen werden als Schutzziele formuliert. Dadurch wird eine hohe Flexibilität für den Arbeitgeber erreicht.
- Konkrete Prüfvorschriften für besonders gefährliche Arbeitsmittel wie Krane, Gasverbrauchseinrichtungen und bühnentechnische Einrichtungen (Anhang 3)
Rechtlicher Hinweis
Rechtlich verbindlich ist ausschließlich der Wortlaut der Betriebssicherheitsverordnung. Die hier vorliegenden Informationen sind weder vollständig noch rechtsverbindlich. Die auf diesen Seiten aufbereiteten Informationen sollen einen Überblick und eine Einführung zur Prüfung und Kennzeichnung nach der BetrSichV geben. Daher empfehlen wir, sich auf die Verordnung selbst zu beziehen
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung

Anwendungsgebiete der ASR A3.4
Die ASR A3.4 definiert, wann eine Sicherheitsbeleuchtung oder ein optisches Sicherheitsleitsystem in Arbeitsstätten erforderlich sein kann. Weiterhin beschreibt sie die konkreten lichttechnischen Anforderungen von Sicherheitsbeleuchtung und langnachleuchtenden und elektrischen Sicherheitsleitsystemen. Die ASR A3.4 dient der Festlegung der Sicherheit und dem Gesundheitsschutz der Mitarbeiter durch das Betreiben der Beleuchtung. Für ausgewählte Tätigkeiten beschreibt diese Arbeitsstättenverordnung die geforderte Beleuchtung, damit die Beschäftigten Ihren Sehaufgaben nachkommen können. Die Wichtigkeit des Tageslichts am Arbeitsort wird so weit berücksichtigt, dass die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter nicht gefährdet wird. Die ASR A3.4 bezieht sich auf die künstliche und natürliche Beleuchtung von Arbeitsplätzen im Innen- sowie Außenbereich, sofern keine betrieblichen Gründe dagegen sprechen, wie z.B. ein Fotolabor, welches eine spezielle Beleuchtung benötigt.
Helligkeit durch Tageslicht
Ein Arbeitsplatz sollte wenn möglich genug Tageslicht erlangen. Tageslicht ist gegenüber einer künstlichen Beleuchtung stets zu präferieren. Tageslicht wirkt im Allgemeinen vorteilhaft auf die Gesundheit und das positive Befinden der Mitarbeiter. Es sollte allerdings ein Blenden durch einfallende Sonnenstrahlen mithilfe von Rollos oder Jalousien verhindert oder zumindest verringert werden.
Voraussetzung für künstliche Beleuchtung im Innenbereich
Zusätzliches Licht ist meistens erforderlich, da nicht ausreichend viel Tageslicht vorhanden ist. Arbeitsplätze müssen dementsprechend gemäß ASR A3.4 mit ausreichend künstlichem Licht ausgestattet werden. Es gibt Fälle, bei denen diese Beleuchtung abweichen kann, da es wie z.B. bei zunehmendem Alter eine Verschlechterung des Sehvermögens geben kann. Beim Betreiben sowie Einrichten von Arbeitsplätzen müssen die vorgegebenen Beleuchtungsstärken eingehalten werden. An keinem anderen Bereich der Arbeitsstelle darf ein gewisser Wert der Beleuchtungsstärke unter- oder überschritten werden. Des Weiteren muss darauf geachtet werden, dass eine Blendung durch einfallende Sonnenstrahlen oder Reflexion minimiert oder wenn möglich ganz behoben wird. Bei der Wahl der Leuchtmittel muss der Arbeitgeber darauf achten, dass gewisse Sicherheitszeichen sowie Rettungszeichen auch als solche wahrgenommen werden.
| Allgemeine Begrifflichkeiten zur ASR A3.4 |
| Arbeitsplatz |
beinhaltet alle Stellflächen, die das Fortsetzen der Arbeit begünstigen sowie die Arbeitsflächen und die sogenannten Bewegungsflächen |
| Arbeitsfläche |
Fläche, auf der die Tätigkeit ausgeübt wird |
| Bewegungsfläche |
Grundfläche am Arbeitsplatz, die dem Mitarbeiter einen Haltungswechsel sowie eine Ausgleichsbewegung ermöglicht |
| Umgebungsbereich |
Dieser Bereich wird durch Verkehrswege oder Wände in den Räumen begrenzt und schließt an einen oder mehrere Bereiche an |
| Teilfläche |
Fläche mit einem hohen Bedürfnis an Sehkraft innerhalb eines Arbeitsplatzes |
Die ausführlichen Informationen der ASR A3.4 finden Sie auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin !
Sicherheits- und Notleuchten
Notwendige
langnachleuchtende Sicherheitsbeleuchtung sowie elektrische Sicherheitsleitsysteme gemäß der Norm ASR
A3.4 finden Sie ebenfalls in unserem
Kroschke SIGN Onlineshop!
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos! Haben Sie Fragen zur ASR A3.4? Rufen Sie uns an - unser Mitarbeiter-Team berät Sie gerne und kompetent: Tel.+49 0531 318-588.
Weitere umfassende Informationen und Praxistipps zu Gesetze und Normen liefert Ihnen der Kroschke SIGN Blog in der Kategorie "Normen und Vorschriften" .
Zur Newsletteranmeldung

BGR 192 - Benutzung von Augen- und Gesichtsschutz
Die BGR 192 findet Anwendung auf die Auswahl von Augen- und Gesichtsschutz zur Prävention von Unfällen am Arbeitsplatz.
Beim Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz sind mechanische, optische, thermische, elektrische, biologische, chemische Gefährdungen in der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen. Die BGR 192 gibt anschauliche Hinweise zur Auswahl des erforderlichen Augen- und Gesichtsschutzes, zu Bereitstellung, Nutzung, Wartungs-, Reparatur- und Ersatzmaßnahmen.
Der genaue Wortlaut der BGR 192 steht hier für Sie zum Download bereit. Mit der Veröffentlichung der neuen DGUV Regel 112-192 ist die BGR 192 unwirksam geworden. Zu unseren Augenschutz Produkten
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung

BGR 200- Benutzung von Stechschutzhandschuhen und Armschützern
Die BGR-Regel bestimmt Kriterien zur Auswahl und Benutzung von Handschuhen, Stulpen und Armschützern zum Schutz vor Schnitt- oder Stechverletzungen im Betrieb.
"Werden bei der Gefährdungsermittlung Gefährdungen der Hände und/oder Arme der Versicherten durch Schnitte und/oder Stiche ermittelt (siehe Abschnitt 3.1.1) und sind diese Gefährdungen nicht durch technische oder organisatorische Maßnahmen zu beseitigen, hat der Unternehmer den gefährdeten Personen nach § 4 der Unfallverhütungsvorschrift „Allgemeine Vorschriften" (BGV A1) geeignete persönliche Schutzausrüstungen, wie Handschuhe, Armschützer, Stulpen oder Kombinationen, zur Verfügung zu stellen." (BGR 200, 3.1)
Der genaue Wortlaut der Berufsgenossenschaftlichen Regel steht für Sie hier zum Download bereit. Mit der Veröffentlichung der neuen DGUV Regel 112-200 ist die BGR 200 unwirksam geworden.
Zu unseren Schnitt-und Stichschutzhandschuhen
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
 Die DGUV 112-196, ehemals BGR 196, findet Anwendung auf die Auswahl und die Benutzung von Stechschutzbekleidung (Stechschutzschürzen, -hemden,- hosen) zum Schutz gegen unbeabsichtigte Stich- oder Schnittverletzungen. Die DGUV 112-196 konkretisiert Bereitstellung und Beschaffenheit verschiedener Stechschutzbekleidung, die bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung eingesetzt werden können und gibt anschauliche Beispiele. Der genaue Wortlaut der DGUV 112-196 steht für Sie hier zum Download bereit. Zu unserer Stechschutzbekleidung
Die DGUV 112-196, ehemals BGR 196, findet Anwendung auf die Auswahl und die Benutzung von Stechschutzbekleidung (Stechschutzschürzen, -hemden,- hosen) zum Schutz gegen unbeabsichtigte Stich- oder Schnittverletzungen. Die DGUV 112-196 konkretisiert Bereitstellung und Beschaffenheit verschiedener Stechschutzbekleidung, die bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung eingesetzt werden können und gibt anschauliche Beispiele. Der genaue Wortlaut der DGUV 112-196 steht für Sie hier zum Download bereit. Zu unserer Stechschutzbekleidung
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung

Die BGV A 1 gilt als wichtigste berufsgenossenschaftliche Regelung.
Sie beschreibt:
- den Geltungsbereich der Unfallverhütungsvorschriften am Arbeitsplatz
- die Pflichten des Unternehmers
- die Pflichten der Mitarbeiter
- die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes (Sicherheitsbeauftragte, Erste Hilfe, Persönliche Schutzausrüstung etc.)
Die BG-Vorschrift ist am 1. Januar 2004 in Kraft getreten. Durch diese Vorschrift wurden viele Unfallverhütungsvorschriften außer Kraft gesetzt. Die Verantwortung für die von diesen Vorschriften abgedeckten Detail-Regelungen ist an die Unternehmer zurückgegeben worden, in der Praxis gelten sie aber als Referenz für den jeweiligen Stand der Technik und werden deshalb weiterhin häufig zu Rate gezogen.
Ergänzt werden die BG-Vorschriften von den Berufsgenossenschaftlichen Regeln (BGR), den Berufsgenossenschaftlichen Informationen (BGI) und den Berufsgenossenschaftlichen Grundsätzen (BGG). Der genaue Wortlaut der BGV A 1 steht für Sie hier zum Download bereit. Zur Produktübersicht Persönliche Sicherheit und Erste Hilfe
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung

BGR 196- Benutzung von Stechschutzbekleidung
Diese BG-Regel findet Anwendung auf die Auswahl und die Benutzung von Stechschutzbekleidung (Stechschutzschürzen, -hemden, -hosen) zum Schutz gegen unbeabsichtigte Stich- oder Schnittverletzungen (siehe auch BG-Regel "Benutzung von Stechschutzhandschuhen und Armschützern" (BGR 200)). Die BGR 196 konkretisiert Bereitstellung und Beschaffenheit verschiedener Stechschutzbekleidung, die bei vorliegender Gefährdungsbeurteilung eingesetzt werden können und gibt anschauliche Beispiele. Der genaue Wortlaut der BGR 196 steht für Sie hier zum Download bereit. Mit der Veröffentlichung der neuen DGUV Regel 112-196 ist die BGR 196 unwirksam geworden.
Zu unserer Stechschutzbekleidung
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung

Berufsgenossenschaftliche Regel 181 - Fußböden in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit Rutschgefahr
Rutschsicherheit gemäß BGR 181
Die Rutschsicherheit wird in Deutschland gemäß DIN 51130 geregelt. Die Rutschhemmung wird auf einer schiefen Ebene mit einem standardisierten Schuh und Gleitmittel gemessen. So werden die Rutschhemmungsklassen R9 (geringste Rutschhemmung) bis R13 (höchste Rutschhemmung) bestimmt.
Der komplette Gesetztestext der BGR 181 steht für Sie zum Download bereit!
Zu den Antirutschbelägen und -profilen
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung

Diese Norm gilt für Verbandskasten, die für die Verwendung in Verwaltungs- und Handelsbetrieben bis 50 Personen, Herstellungs-, Verarbeitungs- und vergleichbaren Betrieben bis 20 Personen und kleineren Baustellen bis 10 Personen vorgesehen sind und bestimmt die Inhaltsmenge an Standardverbandmaterialien. Diese Norm gilt auch für die Verwendung in Schulen und Kindergärten. Der Verbandkasten soll die Erste Hilfe am Unfallort fachgerecht ermöglichen. Die Inhalte der Koffer nach DIN 13157 finden Sie unter Dokumenten-Nummer 667. Zu den Erste Hilfe- Produkten
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
 Die DGUV 112-199, ehemals BGR 199, findet in allen Arbeitsbereichen Anwendung, in denen das Risiko eines Absturzes besteht. Der Unternehmer muss entsprechende Sicherheitsausrüstung und Systeme zur Bergung bereit stellen. Persönliche Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen sind Bestandteile von Rettungssystemen, mit denen Personen aus einer Notlage durch Herausziehen, Auf- oder Abseilen gerettet werden können. Hierzu gehören beispielsweise: Rettungsgurte, Rettungsschlaufen, Rettungshubgeräte, Abseilgeräte, Verbindungsmittel, Verbindungselemente und Anschlageinrichtungen. Die DGUV 112-199 gibt konkrete Anweisungen zur Anwendung, Aufbewahrung und Prüfung der persönlichen Schutzausrüstung. Der genaue Wortlaut der Berufsgenossenschaftlichen Regel steht für Sie hier zum Download bereit. Zu unseren Produkten der Höhensicherung
Die DGUV 112-199, ehemals BGR 199, findet in allen Arbeitsbereichen Anwendung, in denen das Risiko eines Absturzes besteht. Der Unternehmer muss entsprechende Sicherheitsausrüstung und Systeme zur Bergung bereit stellen. Persönliche Schutzausrüstungen zum Retten aus Höhen und Tiefen sind Bestandteile von Rettungssystemen, mit denen Personen aus einer Notlage durch Herausziehen, Auf- oder Abseilen gerettet werden können. Hierzu gehören beispielsweise: Rettungsgurte, Rettungsschlaufen, Rettungshubgeräte, Abseilgeräte, Verbindungsmittel, Verbindungselemente und Anschlageinrichtungen. Die DGUV 112-199 gibt konkrete Anweisungen zur Anwendung, Aufbewahrung und Prüfung der persönlichen Schutzausrüstung. Der genaue Wortlaut der Berufsgenossenschaftlichen Regel steht für Sie hier zum Download bereit. Zu unseren Produkten der Höhensicherung
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
 Die DGUV 112-193, ehemals BGR 193, findet Anwendung auf die Auswahl und Benutzung von Schutzhelmen und Anstoßkappen sowie Kombinationen mit anderen persönlichen Schutzausrüstungen, wie z. B. Gehörschutz, Augen- oder Atemschutz. Sie gibt anschauliche Hinweise zur Passform, jeweiligem Einsatzzweck, sowie zu Anforderungen an Wartung, Reparatur und Ersatz. Der genaue Wortlaut der DGUV 112-193 steht hier für Sie zum Download bereit. Zu unserem Kopf-und Gesichtsschutz
Die DGUV 112-193, ehemals BGR 193, findet Anwendung auf die Auswahl und Benutzung von Schutzhelmen und Anstoßkappen sowie Kombinationen mit anderen persönlichen Schutzausrüstungen, wie z. B. Gehörschutz, Augen- oder Atemschutz. Sie gibt anschauliche Hinweise zur Passform, jeweiligem Einsatzzweck, sowie zu Anforderungen an Wartung, Reparatur und Ersatz. Der genaue Wortlaut der DGUV 112-193 steht hier für Sie zum Download bereit. Zu unserem Kopf-und Gesichtsschutz
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
Leicht verständliche Kennzeichnung für internationale Betriebe!
Gehen Sie mit der DIN ISO 3864-2 auf Nummer sicher – nutzen Sie Ihre Vorteile:
- Text in Amtssprache
- international einsetzbar – ISO 3864-2 ist in länderspezifischen Normen übernommen
- Verwendung von internationalen Symbolen (ISO 7010)
International einsetzbare Produktsicherheitsschilder enthalten zusätzlich zum Text Sicherheitszeichen, um wichtige Informationen über Sprachgrenzen hinweg zu vermitteln. Der Gefährdungsgrad wird durch das Sicherheitszeichen und Signalfarben eingestuft:
- Vorsicht (gelb)
- Warnung (orange)
- Gefahr (rot).
Seit November 2017 gilt: Das Signalwort ist optional und muss damit nicht mehr beim Warnzeichen stehen.
Die ISO 3864 legt internationale Gestaltungsgrundlagen für Sicherheitssymbole fest:
- Gestaltungsgrundlagen für Sicherheitszeichen zur Anwendung in Arbeitsstätten und öffentlichen Bereichen
- Gestaltungsgrundlagen für Sicherheitszeichen auf Produkten
- Gestaltungskriterien für grafische Symbole zur Anwendung in Sicherheitszeichen
Den genauen Wortlaut der ISO 3864 finden Sie beim Beuth-Verlag.

Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
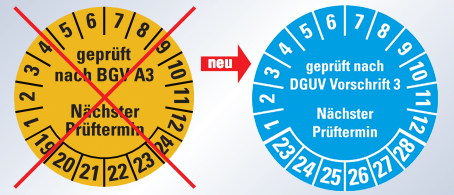
Wie schlüsselt sich das Nummernsystem nach DGUV auf?
Die DGUV (Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung) und BG (Berufsgenossenschaften) haben ein komplett neues Nummernsystem für die bestehenden Regelwerke der Spitzenverbände und öffentlichen Unfallversicherungsträger herausgegeben.
Inhaltlich hat sich an den bisherigen Regelwerken nichts verändert. Sie werden ja nach Typ (Verordnung, Grundregeln, Informationen) in festgelegten Abständen überprüft und erst in diesem Schritt Titel und Verweise auf andere Regelwerke angepasst.
Kürzel wie BGV/GUV-V, BGR/GUV-R, BGI/GUV-I, BGG/GUV-G, GUV-SR, GUV-SI entfallen künftig! Die Inhalte sind vorerst gleichbleibend.
Wir schlüsseln Ihnen das neue System nach DGUV auf:
| Typ |
alt: BG |
alt: GUV |
neu: einheitliche Bezeichnung |
neu: Nummernkreis |
| Vorschrift |
BGV |
GUV-V |
DGUV Vorschriften |
1-99 |
| Information |
BGI |
GUV-I |
DGUV Informationen |
200-299 |
| Regeln |
BGR |
GUV-R |
DGUV Regeln |
100-199 |
| Grundsätze |
BGG |
GUV-G |
DGUV Grundsätze |
300 aufwärts |
Beispiel für die DGUV:
Die BGV A3 heißt jetzt DGUV Vorschrift 3 und die BGR 234 jetzt DGUV Regel 108-007. Die inhaltlichen Aussagen dieser Richtlinien bleiben jedoch absolut gleich.
Die beliebtesten Prüfplaketten nach DGUV
Wir unterstützen Sie bei der Umstellung auf die DGUV!
Diese Liste unterstützt Sie bei der Umstellung Ihrer Prüfplaketten nach BG und GUV. Wir haben Ihnen die Plaketten der alten Regelwerke mit denen des neuen DGUV-Vorschriften- und Regelwerks gegenübergestellt. Nutzen Sie den direkten Vergleich und bestellen Sie Ihre Prüfplaketten schnell und einfach!
Gelten Prüfplaketten mit Aufdruck wie BGV A3 oder BGR 234 jetzt nicht mehr?
Keine Sorge! Da bisher noch keine Übergangsfristen zur endgültigen Umstellung für die Kennzeichnung nach DGVU bekannt sind, können Sie auch weiterhin Prüfplaketten mit den alten Bezeichnungen verwenden. Es empfiehlt sich jedoch, stets nach neuestem Regelwerk zu arbeiten. Wer schon jetzt Prüfplaketten nach neuem DGUV Nummerierungs- und Schriftensystem einsetzt, zeigt Kompetenz und Aktualität auf ganzer Linie!
Sie müssen mehrere Plaketten umstellen? Nutzen Sie unsere kostenlose Prüf- und Bestellliste als pdf-Download. Der direkte Vergleich zeigt Ihnen, welche Plaketten umzustellen sind.
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
Die 2-oder 3-teilige Kennzeichnung nach ISO 11684 besteht unter anderem aus zwei Piktogrammen und einem optionalen Signalwort. Ein Piktogramm weist hierbei auf die Gefahr hin und das zweite zeigt die empfohlene Verhaltensweise an. Das Signalwort gibt das Ausmaß der Gefahr an.Durch die eindeutige Gestaltung bietet sich die Kennzeichnung nach ISO 11684 für einen sprachübergreifenden & internationalen Verwendungszweck an.Durch die schnelle Bilderfassung hat sich die ISO 11684 in sämtlichen Bereichen der Maschinenkennzeichnung etabliert. Der Ursprung der Norm liegt in der Kennzeichnung von Traktoren und Maschinen für die Land-, Garten- und Forstwirtschaft.
- schnelle Bilderfassung
- in vielen Bereichen der Maschinenkennzeichnung etabliert
- sprachübergreifend und international einsetzbar
- eindeutige Einstufung der Gefahr durch Signalwort möglich

Was regelt die DIN EN ISO 7010?
Die ISO 7010 legt die graphischen Symbole sowie Sicherheitsfarben von Rettungs-, Verbots-, Gebots-, Warn- und Brandschutzzeichen fest. Die ISO enthält für die Betriebswelt relevante Piktogramme, welche vor Gefahren innerhalb der Unternehmen warnen sollen. Durch eine stetige Anpassung an aktuelle Technik ist diese immer aktuell und beinhaltet stetig neue Piktogramme. Diese Anpassungen führten allerdings im Laufe der Jahre zu vielen Änderungen der ursprünglich erschienenen Norm.
Aufgrund der hohen Relevanz der DIN EN ISO 7010 für Unternehmen finden sich teilweise auch Symbole in der Technischen Regel ASR A1.3 wieder. Die ASR A1.3 wird angewendet, wenn ein Betrieb Risiken nicht durch technische oder organisatorische Maßnahmen ausschließen kann. Für den Notfall ist immer wichtig, dass Mitarbeiter Gefahren sofort erkennen können und wissen welches Verhalten zur Unfallvermeidung benötig wird.
Was sind die Vorteile der ISO 7010 für Unternehmen?
Die ISO 7010 deckt branchenübergreifend und auch international verschiedenste Gefahrenbereiche ab, zudem erhöht der hohe Wiedererkennungswert der Piktogramme die Sicherheit im Betrieb. Durch eine internationale Verwendung und ständige Anpassungen ist bei der ISO 7010 immer davon auszugehen, dass auch der neuste Stand der Technik berücksichtigt wurde. Außerdem ist die internationale Norm für jeden auch ohne Sprachkenntnisse verständlich.
Warum ist die ISO 7010 so wichtig für Ihr Unternehmen?
Die Beschilderung von Rettungswegen und Sicherheitsbereichen kann im Notfall Leben retten, denn gerade in Notsituationen zählt jede Sekunde. Eine Einhaltung der Norm gewährleistet somit eine präventive Maßnahme, um die Sicherheit von Ihnen und der Ihrer Mitarbeiter zu garantieren und sollte daher definitiv berücksichtigt werden.
Seit wann gilt die ISO 7010?
Die ISO 7010 erfährt ständige Anpassungen an aktuelle Gegebenheiten im nationalen Raum. Von 2012 bis zum jetzigen Zeitpunkt gab es viele Änderungen, die eine detaillierte Übersicht zuletzt schwieriger gestalteten. Diese Unübersichtlichkeit wurde mit der zusammengefassten Version im Juli 2020 behoben.
Mit der Änderung wurde die internationale Norm ISO 7010 in der nationalen Norm angepasst. Es finden sich viele Piktogramme der internationalen Norm auch in der nationalen Norm wieder. Untern anderem sind nun auch Wasserschutzzeichen Teil der neuen Version. Viele Unternehmen nutzen die (DIN EN) ISO 7010 aufgrund dessen als Ratgeber für normgerechte Anpassungen der Sicherheit nach aktuellem Stand der Technik, vor allem aufgrund der Ähnlichkeit mit den Inhalten der ASR A1.3.. Ausführliche Informationen zur DIN EN ISO 7010 finden Sie hier »
Welche Arten von Schildern betrifft die Norm?
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung »
 Die DGUV 112-191, ehemals BGR 191, findet Anwendung auf die Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Benutzung von Fuß- und Knieschutz zum Schutz vor Verletzungen bei der Arbeit. Der Text beinhaltet eine detaillierte Check-Liste zur Einordnung vorliegender Gefährdungen und zur Auswahlhilfe des richtigen Fuß- und Knieschutzes. Der genaue Wortlaut der DGUV 112-191 steht hier für Sie zum Download bereit.
Zu den Sicherheitsschuhen
Die DGUV 112-191, ehemals BGR 191, findet Anwendung auf die Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Benutzung von Fuß- und Knieschutz zum Schutz vor Verletzungen bei der Arbeit. Der Text beinhaltet eine detaillierte Check-Liste zur Einordnung vorliegender Gefährdungen und zur Auswahlhilfe des richtigen Fuß- und Knieschutzes. Der genaue Wortlaut der DGUV 112-191 steht hier für Sie zum Download bereit.
Zu den Sicherheitsschuhen
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
 Die DGUV-Regel 112-190, ehemals BGR 190/GUV-R 190, konkretisiert die Forderungen der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV/GUV-V A1) hinsichtlich der Benutzung von Atemschutzgeräten für die Arbeit und die Rettung sowie für die Selbstrettung. In dieser DGUV-Regel werden die Atemschutzgerätetypen und ihre Einteilung, Kennzeichnung, Auswahl, ihr Einsatz und ihre Instandhaltung behandelt. Sie enthält Festlegungen über die Anforderungen an die Geräteträger und Gerätewarte und an deren Aus- und Fortbildung sowie Unterweisung. Dabei sind die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes und der PSA-Benutzungsverordnung berücksichtigt. Den genauen Wortlaut der DGUV-Regel 112-190 können Sie in der Bibliothek der Berufsgenossenschaften herunterladen.
Zu den Atemschutzmasken
Die DGUV-Regel 112-190, ehemals BGR 190/GUV-R 190, konkretisiert die Forderungen der Unfallverhütungsvorschrift "Grundsätze der Prävention" (BGV/GUV-V A1) hinsichtlich der Benutzung von Atemschutzgeräten für die Arbeit und die Rettung sowie für die Selbstrettung. In dieser DGUV-Regel werden die Atemschutzgerätetypen und ihre Einteilung, Kennzeichnung, Auswahl, ihr Einsatz und ihre Instandhaltung behandelt. Sie enthält Festlegungen über die Anforderungen an die Geräteträger und Gerätewarte und an deren Aus- und Fortbildung sowie Unterweisung. Dabei sind die Vorschriften des Arbeitsschutzgesetzes und der PSA-Benutzungsverordnung berücksichtigt. Den genauen Wortlaut der DGUV-Regel 112-190 können Sie in der Bibliothek der Berufsgenossenschaften herunterladen.
Zu den Atemschutzmasken
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
Benutzung von Schutzkleidung
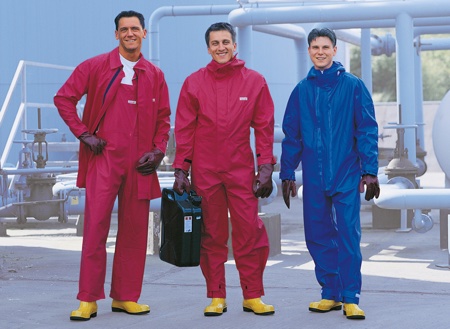 Die BGR 189 findet Anwendung auf die Auswahl und Benutzung von Schutzkleidung zum Schutz vor Verletzungen bei der Arbeit. Geeignete Schutzmaßnahmen gegen mechanische Einwirkungen, Erfasstwerden durch bewegte Teile, thermische Einwirkungen, Nässe, Wind, Stäube, Gase, heiße Dämpfe, elektrische Energie, Flammen, Funken, feuerflüssige Massen, chemische Stoffe, Mikroorganismen, Kontamination mit radioaktiven Stoffen werden ausführlich erläutert. Die BGR enthält eine praktische Checkliste zur Einordnung vorliegender Gefährdungen und zur Spezifikation der passenden Schutzausrüstung.
Hier finden Sie den genauen Wortlaut der BGR 189 zum Download .
Zu unserer Auswahl an Schutzkleidung
Die BGR 189 findet Anwendung auf die Auswahl und Benutzung von Schutzkleidung zum Schutz vor Verletzungen bei der Arbeit. Geeignete Schutzmaßnahmen gegen mechanische Einwirkungen, Erfasstwerden durch bewegte Teile, thermische Einwirkungen, Nässe, Wind, Stäube, Gase, heiße Dämpfe, elektrische Energie, Flammen, Funken, feuerflüssige Massen, chemische Stoffe, Mikroorganismen, Kontamination mit radioaktiven Stoffen werden ausführlich erläutert. Die BGR enthält eine praktische Checkliste zur Einordnung vorliegender Gefährdungen und zur Spezifikation der passenden Schutzausrüstung.
Hier finden Sie den genauen Wortlaut der BGR 189 zum Download .
Zu unserer Auswahl an Schutzkleidung
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
Zum ersten Mal werden die Anforderungen der Arbeitsstättenverordnung bezüglich der Gefährdungsbeurteilung nach §3 ArbStättV mithilfe der neuen Technischen Regel für Arbeitsstätten ASR V3 präzisiert. Durch die Technischen Regeln wird der aktuelle Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene dargestellt.
Die ASR V3 regelt die Beurteilung möglicher Gefahren sowie die Maßnahmen zur Gefährdungsbeseitigung beim Einrichten und Betreiben einer Arbeitsstätte. Eine Gefährdung beinhaltet die Möglichkeit einer gesundheitlichen Einschränkung oder eines Gesundheitsschadens.
Was bedeutet das für Ihren Betrieb?
Betriebe können für sich die so genannte Vermutungswirkung geltend machen, wenn sie sich während der Gefährdungsbeurteilung an die Vorgaben aus der ASR halten. Eine Gefährdungsbeurteilung muss von fachkundigem Personal durchgeführt werden. Wenn der Arbeitgeber dieses Wissen nicht hat, muss er sicherstellen, dass er sich von jemandem mit entsprechendem Sachverstand beraten lässt. Fachkundig ist derjenige, der über die notwendigen Fachkenntnisse verfügt, die zur Durchführung der geforderten Aufgaben in den technischen Regeln dienen. Der Umfang der Kenntnisse ist unterschiedlich, da sie von der ermessenen Gefährdung abhängig sind.
| Gemäß der ASR werden folgende Gefährdungen geprüft: |
Der Prozess der Beurteilung ist in unterschiedliche Punkte aufgeteilt: |
| Gefahrstoffe |
Gefährdungsbeurteilung vorbereiten |
| Elektrische und mechanische Risiken |
Gefährdungen ermitteln |
| Biologische Arbeitsstoffe |
Gefährdungen beurteilen |
| Biologische Arbeitsstoffe |
Maßnahmen festlegen |
| Risiken durch Explosionen und Brände |
Maßnahmen umsetzen |
| Thermische Risiken |
Effektivität der Maßnahmen testen |
| Risiken durch physikalische Einflüsse |
Dokumentieren |
| Risiken durch spezielle Arbeitsumgebung |
Fortführen |
| Risiken durch spezielle physische oder psychische Einflüsse |
|
| Sonstige Risiken |
|
Wir unterstützen Sie!
Haben Sie Fragen zur praktischen Umsetzung der ASR V3 und zur normgerechten Gefährdungsbeurteilung? Rufen Sie uns an - unser Mitarbeiter-Team berät Sie gerne und kompetent: Tel.+49 0531 318-588.
Weitere umfassende Informationen und Praxistipps zu Gesetze und Normen liefert Ihnen der Kroschke SIGN Blog in der Kategorie "Normen und Vorschriften" .

Benutzung von Atemschutzgeräten
Die BGR 190 findet Anwendung auf die Wahl und die Benutzung von Atemschutzgeräten für die Arbeit und die Rettung sowie für die Selbstrettung. In dieser BG-Regel werden die Atemschutzgerätetypen und ihre Einteilung, Kennzeichnung, Auswahl, ihr Einsatz und ihre Instandhaltung behandelt. Sie enthält Festlegungen über die Anforderungen an die Geräteträger und Gerätewarte und an deren Aus- und Fortbildung sowie Unterweisung. Der genaue Wortlaut der BGR 190 steht hier für Sie zum Download bereit. Mit der Veröffentlichung der neuen DGUV Regel 112-190 ist die BGR 190 unwirksam geworden.
Zu den Atemschutzgeräten
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung

Benutzung von Kopfschutz
Die BGR 193 findet Anwendung auf die Auswahl und Benutzung von Schutzhelmen und Anstoßkappen sowie Kombinationen mit anderen persönlichen Schutz- ausrüstungen, wie z. B. Gehörschutz, Augen- oder Atemschutz.
Sie gibt anschauliche Hinweise zur Passform, jeweiligem Einsatzzweck, sowie zu Anforderungen an Wartung, Reparatur und Ersatz. Der genaue Wortlaut der BGR 193 steht hier für Sie zum Download bereit. Mit der Veröffentlichung der neuen DGUV Regel 112-193 ist die BGR 193 unwirksam geworden. Zu unserem Kopf-und Gesichtsschutz
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung

Rutschsicherheit gemäß DGUV 108-003, ehemals BGR 181
Die Rutschsicherheit wird in Deutschland gemäß DIN 51130 geregelt. Die Rutschhemmung wird auf einer schiefen Ebene mit einem standardisierten Schuh und Gleitmittel gemessen. So werden die Rutschhemmungsklassen R9 (geringste Rutschhemmung) bis R13 (höchste Rutschhemmung) bestimmt.
Der komplette Gesetztestext der DGUV 108-003 steht für Sie zum Download bereit!
Zu den Antirutschbelägen und -profilen
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung

BGR 195- Einsatz von Schutzhandschuhen
Die BGR-Regel findet Anwendung auf die Auswahl und die Benutzung von Schutzhandschuhen zum Schutz gegen schädigende Einwirkungen mechanischer, thermischer und chemischer Art sowie gegen Schäden durch Mikroorganismen und ionisierende Strahlen. Die BGR 195 beinhaltet eine detaillierte Checkliste zur Einordnung vorliegender Gefährdungen und zur Auswahlhilfe des richtigen Schutzhandschuhs. Der genaue Wortlaut der BGR 195 steht hier für Sie zum Download bereit. Mit der Veröffentlichung der neuen DGUV Regel 112-195 ist die BGR 195 unwirksam geworden.
Zu den Schutzhandschuhen
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung

PSA-Benutzerverordnung (PSA-BV, staatlich)
Diese Verordnung gilt für die Bereitstellung persönlicher Schutzausrüstungen durch den Arbeitgeber sowie die Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen durch Beschäftigte bei der Arbeit und deren Unterweisung im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes.
Der genaue Wortlaut der PSA- Benutzerverordnung steht für Sie hier zum Download bereit.
Zu unseren Produkten der Persönlichen Schutzausrüstung
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
 Ausführliche und aktuelle Informationen zum Thema "Chemikalien im Betrieb" finden Sie auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).
Ausführliche und aktuelle Informationen zum Thema "Chemikalien im Betrieb" finden Sie auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).
- REACH/CLP
- Biozide
- Frühere Verfahren für Alt- und Neustoffe
- Rechtstexte
Zu den Gefahrstoffetiketten
Hier finden Sie Informationen zur aktuellen GHS/CLP Verordnung 2015
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
 Diese Norm gilt für Verbandkästen, die für die Verwendung in Verwaltungs- und Handelsbetrieben ab 51 Personen, Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben ab 21 Personen und Baustellen ab 11 Personen vorgesehen sind und bestimmt die Inhaltsmenge an Standardverbandmaterialien. Diese Norm gilt auch für die Verwendung in Schulen und Kindergärten. Der Verbandkasten soll die Erste Hilfe am Unfallort fachgerecht ermöglichen. Die Inhalte der Koffer nach DIN 13169 finden Sie in der Inhaltsliste für Erste Hilfe Koffer nach DIN 13169.
Alle Erste-Hilfe-Produkte von Söhngen
Diese Norm gilt für Verbandkästen, die für die Verwendung in Verwaltungs- und Handelsbetrieben ab 51 Personen, Herstellungs- und Verarbeitungsbetrieben ab 21 Personen und Baustellen ab 11 Personen vorgesehen sind und bestimmt die Inhaltsmenge an Standardverbandmaterialien. Diese Norm gilt auch für die Verwendung in Schulen und Kindergärten. Der Verbandkasten soll die Erste Hilfe am Unfallort fachgerecht ermöglichen. Die Inhalte der Koffer nach DIN 13169 finden Sie in der Inhaltsliste für Erste Hilfe Koffer nach DIN 13169.
Alle Erste-Hilfe-Produkte von Söhngen
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
Änderung der DIN 13164 für KFZ-Verbandkästen
Mit der Überarbeitung der DIN werden zum 01.02.2022 die Inhalte von KFZ-Verbandkästen angepasst, die in Kraftfahrzeugen (PKW, LKW und Busse) mitzuführen sind. Art und Umfang der Materialien wurden neusten Erkenntnissen angepasst, um am Unfallort fachgerechte Erste Hilfe leisten zu können.
Der Inhalt unserer KFZ-Verbandkästen wurde mit der neuen DIN 13164:2022 um Gesichtsmasken für Ersthelfer ergänzt.
Die Aktualisierung der DIN 13164 bietet einen guten Anlass, um alle Fahrzeuge zu kontrollieren: Sind Pflaster noch klebefähig, Verbandstoffe haltbar und alle Materialien vollständig?
Unsere Garantie: die Inhalte unserer Produkte entsprechen der DIN 13164:2014 und wurden um zwei Masken nach der neuen DIN 13164:2022 ergänzt. Um Ihre Geschäftsfahrzeuge oder Ihren Fuhrpark auszustatten, finden Sie alle KFZ-Verbandkästen in unserer Kategorie Verbandskasten und Erste Hilfe Koffer.
Welche Ausrüstung benötige ich im Straßenverkehr?
Welches Fahrzeug welchen Ausrüstungsgegenstand in Deutschland mitführen muss sehen Sie in unsere Tabelle:
| Erste-Hilfe-Koffer gemäß DIN 13164 |
Warndreieck |
Warnweste gemäß EN 471 Pflicht seit 01.07.2014 |
Warnleuchte |
Feuerlöscher |
Handscheinwerfer |
| PKW |
X |
X |
X |
|
|
|
| LKW |
X |
X |
X |
X |
|
|
| Bus |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| Motorrad |
|
|
|
|
|
|
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
KFZ-Verbandkästen mit Füllung gemäß DIN 13164:2022
ADR 2025: Übergangsfrist bis zum 30.06.2025
Die ADR-Vorschriften wurden für das Jahr 2025 erneut angepasst.
Das ADR wurde unter anderem um 2 neue UN-Nummern im Bereich Batterien ergänzt (UN 3551 und UN 3552). Diese neu eingeführten Nummern beziehen sich auf den Transport von Natrium-Ionen-Batterien. Die Übergangsfrist zur Umsetzung der Änderungen endet am 30. Juni 2025.
Neue ADR 2023 - Übergangsfrist bis 30.06.2023
Für das Jahr 2023 wurde die ADR wieder aktualisiert - die Übergangsfrist endet am 30.06.2023!
Das hat sich geändert: Die Angabe der Telefonnummer ist ab 2023 nicht mehr verpflichtend. Bis zum 31.12.2026 dürfen jedoch noch alte Lithiumbatteriekennzeichnung (mit Telefonnummer) verwendet werden.
Neue ADR seit dem 01.01.2021
WICHTIG im Jahr 2021: Die Größen der in 2019 eingeführten Kennzeichen für Lithium-Batterien wurde nochmals angepasst!
Nicht erst seitdem Smartphones mit brennenden oder explodierenden Lithium-Akkus aufhorchen ließen, ist der Transport von Lithium-Batterien ein heißes Thema. Bei unsachgemäßer Behandlung, Lagerung und Transport von Batterien entsteht schnell eine Explosions- und Brandgefahr. Während des Transports auf der Straße oder in einem Flugzeug können die Folgen einer Explosion von Batterien schwerwiegend sein. Darauf haben die Kommissionen bereits bei der Erarbeitung der neuen Transportregelungen 2017 für Gefahrgut reagiert. Bereits seit April 2016 dürfen größere Mengen Lithium-Batterien nicht mehr in Passagierflugzeugen transportiert werden. Gemäß IATA-DGR (Luftfahrt) muss jedes Packstück mit Lithium-Batterien (UN 3090, UN 3480) zusätzlich zu allen anderen erforderlichen Kennzeichen das Label „Cargo Aircraft Only“ tragen.
Gefahrzettel 9A seit 01.01.2019 verpflichtend
Seit dem 01.01.2017 weist der neue Gefahrzettel 9A nun explizit auf den Paketinhalt mit Lithium-Batterien hin und nicht mehr nur auf „Verschieden gefährliche Stoffe“ (Gefahrzettel 9). Für die Plakatierung von Umschließungen (Container, Fahrzeug) darf bei Lithium-Batterien weiterhin nur der Gefahrzettel Klasse 9 verwendet werden.
Für die bezettelungspflichtigen Versandstücke mit UN 3090, 3091, 3480 oder 3481 ist nicht mehr die Nummer 9, sondern die neue Nummer 9A gültig! Fallen die Packstücke unter die Sondervorschrift 188 müssen andere Kennzeichen verwendet werden:
Ergänzung zu Gefahrzetteln für Lithium-Batterien
Ergänzt wird der Gefahrzettel 9A für Verpackungen von Lithium-Batterien noch durch die unten genannten Kennzeichen. Wichtig an diesem Kennzeichen ist, alle UN Nummern des Verpackungsinhalts auf diesem Etikett zu vermerken. Wenn die Telefonnummer des Versenders nicht anderweitig auf der Verpackung angegeben ist, muss diese zusätzlich auf dem Etikett eingetragen werden. Da im Bedarfsfall zusätzliche Informationen vom Versender eingeholt werden müssen. Das neue Kennzeichen ersetzt die bisherigen Regelungen im Straßen- und Bahnverkehr (ADR/RID), bei der Binnenschifffahrt (ADN), in der Seefahrt (IMDG-Code). Zusätzlich ist das neue Kennzeichen auch im Luftverkehr (IATA) gültig.
Ihr Vorteil: Künftig gibt es somit nur noch ein Kennzeichen für alle Verkehrsträger!
Unsere Qualität gemäß IMDG-Code
Laut Anforderungen des IMDG-Codes müssen Angaben auf Gefahrgutetiketten seewasserbeständig und nach mindestens 3 Monaten im Seewasser weiterhin erkennbar sein. Unsere Etiketten wurden von einem unabhängigen Institut nach dem British Standard 5609 geprüft. Mit den Etiketten von Kroschke SIGN erfüllen Sie alle Vorgaben aus dem IMDG-Code!
Die Abkürzungen der Transportwege
- ADR/RID (Straßen- und Bahnverkehr)
- GGVSEB(Straßen,Eisenbahnen und Binnenschifffahrt)
- IATA-DGR(Luftfahrt)
- IMDG-Code(Seefahrt)
Unsere Empfehlung
Das ADR und die Regelwerke für die weiteren Transportwege haben in den letzten Jahren diverse Anpassungen erfahren. Bei uns bekommen Sie geprüfte und den aktuellen Vorschriften entsprechende Kennzeichnung. Transporte, die mit Gefahrgutkennzeichnung versehen werden, sollten dennoch immer von einem Sicherheitsbeauftragen auf Ihre Gültigkeit geprüft werden!
Sie haben Fragen zur richtigen Kennzeichnung und Ausrüstung? Rufen Sie uns an!
Wir beraten Sie gern unter Tel. +49 531 318-318 oder nutzen Sie unser Kontaktformular
Technische Regeln für Arbeitsstätten - Maßnahmen gegen Brände ASR A2.2
Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse
für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten wieder.
Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelt bzw. angepasst und vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt gemacht.
Diese ASR A2.2 konkretisiert im Rahmen des Anwendungsbereichs die Anforderungen der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung der Technischen Regeln kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforderungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für die Beschäftigten erreichen.
Diese ASR konkretisiert die Anforderungen an die Ausstattung von Arbeitsstätten mit Brandmelde- und Feuerlöscheinrichtungen sowie die damit verbundenen organisatorischen
Maßnahmen für das Betreiben nach § 3a Absatz 1, § 4 Absatz 3 und § 6 Absatz 3 einschließlich der Punkte 2.2 und 5.2 Absatz 1 g des Anhangs der Arbeitsstättenverordnung.
Hier das Inhaltsverzeichnis der ASR A2.2:
- Zielstellung
- Anwendungsbereich
- Begriffsbestimmungen
- Eignung von Feuerlöschern und Löschmitteln
- Ausstattung für alle Arbeitsstätten
- Ausstattung von Arbeitsstätten mit erhöhter Brandgefährdung
- Organisation des betrieblichen Brandschutzes
- Abweichende/ergänzende Anforderungen für Baustellen
Anhang 1 Standardschema zur Festlegung der notwendigen Feuerlöscheinrichtungen
Anhang 2 Beispiele für die Ermittlung der Grundausstattung
Anhang 3 Beispiele für die Abweichung von der Grundausstattung
Den kompletten Inhalt lesen Sie im pdf-Download der ASR A2.2.
Berufsgenossenschaftliche Information - Erste Hilfe im Betrieb
Die DGUV 204-022 „Erste Hilfe im Betrieb" (früher BGI/GUV-I 509) richtet sich an alle Personen, die darum bemüht sind, dass bei Unfällen im Betrieb Verletzte die notwendige Erste Hilfe erhalten. Die umfassende Unfallverhütungsvorschrift BGV A 1 (Grundsätze der Prävention) bestimmt allgemein die Maßgaben zur Organisation der Ersten Hilfe im Betrieb. Die praxisnahe berufsgenossenschaftliche Information DGUV 204-022 konkretisiert diese Vorgaben und beantwortet durch die Unfallverhütungsvorschrift aufgeworfene Fragen. Dabei bezieht sie andere relevante Vorschriften mit ein - insbesondere das staatliche Recht.
Informationen zu den neuen Nummern der DGUV finden Sie hier.
Zur Gesamtübersicht Erste Hilfe

Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
Im März 2021 wurde die Neufassung der ASR A3.7 veröffentlicht. Sie definiert maximal zulässige Lärmpegel in Abhängigkeit von der Tätigkeit. Unter Umständen müssen schon ab 55 dB(A) bzw. 70 dB(A) Lärmschutzmaßnahmen getroffen werden. Aktuelle Infos zum Thema Gehörschutz ➤
Die PSA-Verordnung stuft Gehörschutz in die Kategorie III (Schutz vor tödlichen Gefahren und irreversiblen Gesundheitsschäden) ein. Hier gelten strenge Sicherheitsauflagen bei Herstellern, allen beteiligten Wirtschaftsakteuren und Anwendern. Sie sind verpflichtet, Ihre Beschäftigten praktisch in der Anwendung und Benutzung der PSA Kat. III zu unterweisen!
Die Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrations-ArbSchV) fordert, alle Beschäftigten vor Gefährdungen durch Lärm zu schützen. Wenn die durchschnittliche Geräuschkulisse am Arbeitsplatz 80 dB(A) überschreitet oder wenn Schallereignisse auftreten, die über 135 dB(C) liegen, ist Gehörschutz bereitzustellen. Ab 85 dB(A) bzw. 137 dB(C) muss Gehörschutz getragen werden. Der Arbeitgeber muss dies sicherstellen und Lärmbereiche kennzeichnen. Die Vorgaben der LärmVibrationsArbSchV werden in der TRLV Lärm konkretisiert.
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung ➤
 Die DGUV 112-189, ehemals BGR 189, findet Anwendung auf die Auswahl und Benutzung von Schutzkleidung zum Schutz vor Verletzungen bei der Arbeit. Geeignete Schutzmaßnahmen gegen mechanische Einwirkungen, Erfasst werden durch bewegte Teile, thermische Einwirkungen, Nässe, Wind, Stäube, Gase, heiße Dämpfe, elektrische Energie, Flammen, Funken, feuerflüssige Massen, chemische Stoffe, Mikroorganismen, Kontamination mit radioaktiven Stoffen werden ausführlich erläutert. Die BGR enthält eine praktische Checkliste zur Einordnung vorliegender Gefährdungen und zur Spezifikation der passenden Schutzausrüstung. Hier finden Sie den genauen Wortlaut der DGUV 112-189 zum Download .
Zu unserer Auswahl an Schutzkleidung
Die DGUV 112-189, ehemals BGR 189, findet Anwendung auf die Auswahl und Benutzung von Schutzkleidung zum Schutz vor Verletzungen bei der Arbeit. Geeignete Schutzmaßnahmen gegen mechanische Einwirkungen, Erfasst werden durch bewegte Teile, thermische Einwirkungen, Nässe, Wind, Stäube, Gase, heiße Dämpfe, elektrische Energie, Flammen, Funken, feuerflüssige Massen, chemische Stoffe, Mikroorganismen, Kontamination mit radioaktiven Stoffen werden ausführlich erläutert. Die BGR enthält eine praktische Checkliste zur Einordnung vorliegender Gefährdungen und zur Spezifikation der passenden Schutzausrüstung. Hier finden Sie den genauen Wortlaut der DGUV 112-189 zum Download .
Zu unserer Auswahl an Schutzkleidung
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
CLP/GHS-Verordnung 2015: Etiketten von Kroschke SIGN
Ihre Pflicht seit 01.06.2015 müssen sowohl Ihre Stoffe als auch Gemische gemäß CLP/GHS-Verordnung 2015 gekennzeichnet und im Sicherheitsdatenblatt eingestuft sein! Weitere Informationen finden Sie unter www.baua.de (Stichwort GHS). Kroschke SIGN ist Ihr kompetenter Partner, wenn es um die Kennzeichnung von Gefahrstoffen geht. Denn die Angaben auf den GHS-Etiketten wurden mit fachkundigen Chemikern gemäß CLP-Verordnung erarbeitet. Zusätzlich wurde für Sie in Kooperation mit der DLAC eine Auswahl an GHS-Etiketten der gängigsten Gefahrstoffe und Gemische gemäß CLP/GHS für den industriellen Gebrauch zusammengestellt.
Zusammenfassung zum Thema GHS/CLP-Verordnung 2015
- das „Globally Harmonized System of Classification, Labelling and Packing of Chemicals“ (GHS) steht für die weltweit einheitliche Gefahreneinstufung und Kennzeichnung von Chemikalien und ist Grundlage für die CLP-Verordnung 2015
- seit dem 26.11.2010 verweist die Gefahrstoffverordnung zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Chemikalien auf die CLP-Verordnung 2015
- für die Kennzeichnung von Stoffen ist die Kennzeichnung gemäß GHS/CLP seit dem 01.12.2010 gesetzlich vorgeschrieben, bei Gemischen gilt eine Übergangsfrist zum 01.06.2015
- die CLP-Verordnung 2015 findet nur Anwendung im Bereich des Inverkehrbringens
- detaillierte Richtlinien zur innerbetrieblichen Gefahrstoffkennzeichnung sind die aktuellen Technischen Regel für Gefahrstoffe 201 (11/2011) angegeben, die sich ebenfalls auf die CLP-Verordnung 2015 bezieht
Ihre Fristen zur Umsetzung der GHS/CLP-Verordnung 2015
Ab 01.06.2015:
Kennzeichnung von Gemischen gemäß GHS/CLP, Einstufung im Sicherheitsdatenblatt gemäß GHS/CLP-Verordnung 2015 für Stoffe und Gemische
Bis 01.06.2017:
Übergangsfrist zum Abverkauf der Lagerbestände von Gemischen mit alter Kennzeichnung gemäß GefStoffV 2010
Seit 01.12.2010:
Kennzeichnung von Stoffen gemäß GHS/CLP-Verordnung 2015
Seit 01.12.2012:
Kennzeichnung Ihrer Lagerbestände von Stoffen gemäß GHS/CLP-Verordnung 2015
Einmaliger Service: von der Einstufung bis zum fertigen Gefahrstoffetikett!
Wir sind Ihr kompetenter Partner für Ihre Umstellung auf GHS-Verordnung:
- Nutzen Sie unsere Stoffsammlung: Für über 80 Stoffe und Gemische haben wir fertige Etiketten gemäß der neuen GHS/CLP-Verordnung 2015 erstellt
- Bestellen Sie Ihre individuellen GHS-Etiketten: Wir drucken Ihre neuen Gefahrstoffkennzeichen mit allen nötigen Symbolen und Texten nach Ihren Vorgaben – ohne Mindestmengen, volle Gestaltungsfreiheit bei kurzer Lieferzeit
- Wir definieren die Inhalte Ihres GHS-Etiketts: Sie ersparen sich die mühevolle Festlegung der Inhalte, die unser kompetenter Partner für Sie übernimmt. Wir drucken Ihre GHS-Etiketten auch nach Vorlage Ihrer Sicherheitsdatenblätter
- Unser GHS-Komplettservice: Gemeinsam mit Experten unseres Partners übernehmen wir die Einstufung Ihrer Stoffe, die Erstellung neuer Datenblätter und die richtige Kennzeichnung nach GHS/CLP
Haben Sie weitere Fragen zu unseren Produkten und Dienstleistungen? Dann senden Sie uns eine E-Mail, nutzen Sie das Kontaktformular oder rufen Sie uns an unter +49 531 318-588.
Infoseiten über die GHS/CLP-Verordnung 2015
Wir wollen Sie bei der Umstellung unterstützen. Wir berichten über:
Ziele, Inhalte und Fristen der GHS-Verordnung
CLP/GHS-Verordnung – von der Entstehung bis zur Umsetzung
Während der UN-Konferenz für Umwelt und Entwicklung 1992 in Rio de Janeiro forderten die beteiligten Staaten, dass weltweit eine Harmonisierung der Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS – globally harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) eingeführt wird. Auf dem Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung 2002 in Johannesburg wurden die Staaten dazu aufgefordert, GHS so bald wie möglich umzusetzen. 2003 wurden die Inhalte von GHS mit dem sogenannten "purple book" erstmals vorgelegt. Es wird kontinuierlich erweitert und verbessert. Alle zwei Jahre erscheint eine aktualisierte Fassung. Seit 2008 ist das neue Einstufungs- und Kennzeichnungssystem weltweit anwendbar.
GHS-Verordnung sorgt für höheres Schutzniveau
Weltweit werden Chemikalien hergestellt und gehandelt. Ihre Gefahren sind überall dieselben. Aus diesem Grund soll die Beschreibung und Darstellung der Gefahren von einem Produkt von Land zu Land gleich sein. Ziel ist es, mit dieser Vereinheitlichung das Schutzniveau für die menschliche Gesundheit und für die Umwelt transparenter und vergleichbarer zu machen. So haben Staaten, die bislang noch nicht über solche Vorschriften verfügen, die Regelungen gemäß CLP/GHS-Verordnung übernommen. Um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, ist die CLP/GHS-Verordnung modular aufgebaut. Es müssen nicht alle Inhalte übernommen werden. Die Elemente, die übernommen werden, dürfen den Inhalten der CLP/GHS-Verordnung nicht widersprechen. Das Global harmonisierte System regelt weltweit die einheitliche Einstufung und Kennzeichnung für das Inverkehrbringen und für den Umgang mit Gefahrstoffen am Arbeitsplatz sowie beim Transport von gefährlichen Gütern. Es erfolgt eine gleiche Kommunikation in verschiedenen Bereichen:
- Kennzeichnung der Waren für Inverkehrbringer (Händler und Hersteller)
- Transportkennzeichnung
- Sicherheitsdatenblätter
- Verbraucherschutz
Langfristig entstehen Unternehmen mit der Umsetzung der CLP/GHS-Verordnung weniger Kosten, da sie die Gefahrenmerkmale ihrer chemischen Erzeugnisse nicht anhand unterschiedlicher nationaler Kriterienkataloge bewerten müssen.

CLP/GHS-Verordnung in der EU
Das derzeitige EU-Chemikalienrecht und die CLP/GHS-Verordnung sind vom Konzept vergleichbar. Beide regeln die Einstufung und die Verpackung von Chemikalien sowie die Gefahrenkommunikation. Bisher ist dieser Bereich in den EG-Richtlinien "Richtlinie über gefährliche Stoffe" (67/548/EWG) und "Richtlinie über gefährliche Zubereitungen" (1999/45/EWG) vorgeschrieben. Mit diesen Richtlinien wurde ein europäischer Binnenmarkt für Chemikalien realisiert. Am 20. Januar 2009 ist die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 – auch CLP/GHS-Verordnung (Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures) genannt – in Kraft getreten. Die CLP-Verordnung ist die Umsetzung der GHS-Verordnung (die Bezeichnung GHS und CLP werden synonym verwendet) und ersetzt schrittweise die bisherigen EG-Richtlinien. Einige Regelungen aus den alten Richtlinien wurden übernommen (so genannte "left overs"), um Gefährdungen abzudecken, die nicht GHS-Standard sind. Die Umsetzung der CLP/GHS-Verordnung in den EU-Mitgliedstaaten: Mit dem Inkrafttreten ist die CLP/GHS-Verordnung im unmittelbaren Recht, eine Umsetzung durch nationale Rechtsvorschriften ist nicht erforderlich.
GHS und Reach
Zwischen der CLP/GHS-Verordnung und der Reach-Verordnung gibt es einige Schnittstellen: Die Bestimmungen in der Reach-Verordnung zum Einstufungs- und Kennzeichnungsverzeichnis wurden nach dem Inkrafttreten durch die CLP/GHS-Verordnung 2015 ersetzt. Andererseits wird die Reach-Verordnung weiterhin die Verpflichtung zur Übermittlung und die Vorgaben zur Erstellung des Sicherheitsdatenblattes regeln. Darüber hinaus sind die Fristen zur Umsetzung aufeinander abgestimmt.
Aufbau der GHS-Verordnung:
Festlegung der Grundregeln und Prinzipien
Anhang I:
Kriterien zur Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen und Gemischen
Anhang II:
Besondere Regeln zur Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
Anhang III:
Liste der Gefahrenhinweise, ergänzende Gefahrenmerkmale und Kennzeichnungselemente
Anhang IV:
Liste Sicherheitshinweise
Anhang V:
Gefahrenpiktogramme
Anhang VI:
Liste der harmonisierten Einstufung und Kennzeichnung für bestehende Stoffe (Tabelle 3.1 neue Einstufung, Tabelle 3.2. alte Einstufung und Kennzeichnung)
Anhang VII:
Umwandlungstabelle, Einstufung gemäß Stoff-Richtlinien nach GHS-Verordnung
1.2. Grundprinzipien der Einstufung gemäß GHS-Verordnung
Stoffe und Gemische entsprechend der normativen Vorgaben richtig einzustufen, ist ein komplexer Vorgang. An dieser Stelle erklären wir nur kurz die Grundprinzipien. Im Anhang I der CLP/GHS-Verordnung 2015 sind die Einstufungskriterien ausführlich beschrieben. Die Grundprinzipien aus dem Chemikalienrecht (Stoff- und Zubereitungsrichtlinie) bleiben in der CLP/GHS-Verordnung 2015 bestehen: Einstufung und Kennzeichnung nach GHS/CLP beruhen auf den Eigenschaften der betrachteten Stoffe und Gemische. Die gefahrenrelevanten Eigenschaften der Stoffe und Gemische werden in physikalische Gefahren, Gesundheitsgefahren und Umweltgefahren eingeteilt. Die drei Gefahrenbereiche unterscheiden sich in einigen Kriterien zum bisherigen europäischen Chemikalienrecht. Hier die wichtigsten Unterschiede:
Physikalisch-chemische Gefahren gemäß CLP/GHS-Verordnung 2015
- Erweiterung des Eigenschaftsumfangs von 5 auf 16 Stoffgruppen
- Zunahme des Prüfumfangs
- Gefahrenpiktogramme für physikalische Gefahren: GHS 01, 02, 03, 04, 05
- Änderung der Flammpunktgrenzen bei entzündlichen Flüssigkeiten
Toxische Gefahren laut CLP/GHS-Verordnung 2015
- Größere Anzahl an Gefahrenklassen von 9 auf 13
- Die neuen Gefahrenkategorien sind nicht immer deckungsgleich mit der bisherigen Differenzierung "sehr giftig – giftig – gesundheitsschädlich". Bestimmte Stoffe werden laut GHS mit einem Totenkopf gekennzeichnet, in der EU bislang mit Xn. Ebenso gibt es Verschiebungen bei reizenden und ätzenden Differenzierungen.
- Gefahrenpiktogramme für Gesundheitsgefahren: GHS 05, 06, 07, 08
Umweltgefahren nach CLP/GHS-Verordnung 2015
- Unterscheidung zwischen akuter und chronischer aquatischer Toxizität
- Kriterien zur Schädigung der Ozonschicht (zusätzlich in der GHS-Verordnung, nicht im GHS der UN enthalten)
- Gefahrenpiktogramm für Umweltgefahren: GHS 09

Die verschiedenen Gefahrenarten werden nach der CLP/GHS-Verordnung 2015 in Gefahrenklassen (im bisherigen Chemikalienrecht: Gefahrenmerkmale) eingeteilt. Innerhalb der Gefahrenklassen gibt es Differenzierungen, die eine genauere Gefährdungsbetrachtung nach beispielsweise Expositionswegen zulassen. Gefahrenklassen und deren Differenzierungen sind in Gefahrenkategorien (Kategorie 1–5) untergliedert. Diese Gefahrenkategorien sind häufig eine Abstufung der jeweiligen Gefahrenstärke (zum Beispiel "hoch entzündlich – leicht entzündlich – entzündlich"). Mit der Einstufung eines Stoffes in eine oder mehrere Gefahrenklassen und Differenzierungen erfolgen die Zuordnung zur Gefahrenkategorie und damit die Auswahl der Gefahrenhinweise (hazard statements). Für die Einstufung ist die Unterscheidung zwischen Stoff und Gemisch sehr wichtig. Einige Methoden können für beide angewandt werden. Andere Verfahren sollen explizit nur für Gemische oder ausschließlich nur für Stoffe eingesetzt werden.
Die harmonisierte Stoffeinstufung laut CLP/GHS-Verordnung 2015 ist verbindlich
In der CLP/GHS-Verordnung wird für eine Reihe von Stoffen eine harmonisierte Einstufung (legal Einstufung) vorgegeben. Diese muss vom Lieferanten übernommen werden. Allerdings kann diese Einstufung unvollständig sein, das heißt, dass nur einige Gefahrenarten berücksichtigt sind. Ist dies der Fall, muss der Lieferant die Einstufung eigenverantwortlich ergänzen.
Selbsteinstufung von Stoffen und Gemischen nach CLP/GHS-Verordnung
Lieferanten sind dazu verpflichtet, die Einstufung von Stoffen dann eigenverantwortlich vorzunehmen, wenn es sich um nicht-eingestufte Stoffe handelt oder um chemische Erzeugnisse, die begrenzt auf einzelne Gefahrenklassen oder Differenzierungen klassifiziert sind. Gemische werden immer selbst eingestuft. Über den Stoff oder das Gemisch müssen alle verfügbaren Informationen ermittelt werden. Eine detaillierte Darstellung der Verfahrensweise ist in der CLP/GHS-Verordnung 2015 dargestellt. Darüber hinaus ist als Handlungshilfe eine Umwandlungstabelle (Anhang VII) bereitgestellt. Hiermit kann eine Einstufung gemäß der Stoffrichtlinie nach Umwandlungstabelle (Anhang VII) der CLP/GHS-Verordnung 2015 vorgenommen werden. Eine Neueinstufung ist dann nicht mehr erforderlich.
Ihre Pflicht:
Ab 01.06.2015 müssen auch Ihre Gemische gemäß GHS/CLP-Verordnung 2015 gekennzeichnet und im Sicherheitsdatenblatt eingestuft sein! Seit 01.12.2010: Kennzeichnung von Stoffen gemäß GHS/CLP-Verordnung 2015.
1.3. Umsetzungsfristen für die Kennzeichnung gemäß CLP/GHS-Verordnung 2015
Die Bestimmungen der CLP/GHS-Verordnung 2015 werden nicht unmittelbar mit dem Stichtag ihres Inkrafttretens verbindlich. Folgende Übergangsbestimmungen sind für die Einstufung, Gefahrenkommunikation und Verpackung von Stoffen und Gemischen verbindlich: In einem zweistufigen Ablauf sollen Stoffe und Gemische gemäß GHS/CLP eingestuft und gekennzeichnet werden. Die Klassifizierung der Stoffe wird in der ersten Umsetzungsstufe erfolgen, da die Bearbeitung der Gemische von den Einstufungsergebnissen der Stoffe abhängig ist. Nach dem Inkrafttreten der Reach-Verordnung sollen Stoffe in einem Zeitraum von dreieinhalb Jahren den neuen Bestimmungen entsprechen. Für Gemische ist ein Umsetzungszeitraum von viereinhalb Jahren vorgesehen. Die Übergangszeit ist vom 01.12.2010 bis zum 01.06.2015 angelegt. Das bedeutet, dass bis 01.06.2015 die GHS/CLP-Verordnung 2015 von den Unternehmen vollständig umgesetzt werden muss.
Zeitplan für Kennzeichnung der Stoffe:
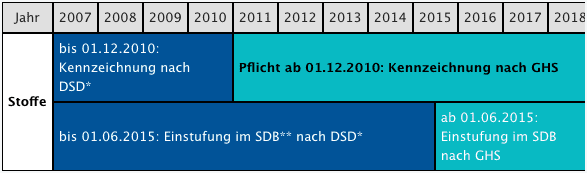
Zeitplan für Kennzeichnung der Gemische:
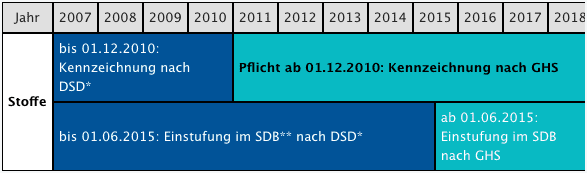
*DSD: Richtlinie 67/548/EWG über gefährliche Stoffe
**SDB: Sicherheitsdatenblatt
1.4. Bedeutung der CLP/GHS-Verordnung 2015 für Unternehmen
Die Auswirkungen von CLP/GHS-Verordnung 2015 auf Unternehmen sind sehr unterschiedlich. Hersteller und Lieferanten von Chemikalien müssen sich bedeutend intensiver mit den neuen Vorschriften gemäß GHS/CLP auseinandersetzen als die Unternehmen, die Chemikalien "nur" anwenden. Aber auch in diesen Betrieben sollten sich die für Arbeitsschutz zuständigen Mitarbeiter rechtzeitig über die Neuerungen informieren. Aufgrund der Umsetzungsfristen müssen sich sowohl Hersteller von Stoffen als auch von Gemischen frühzeitig mit GHS/CLP beschäftigen.
- Durch die schärfere Klassifizierung von Chemikalien müssen Unternehmen unter Umständen mit höheren Arbeitssicherheitsmaßnahmen rechnen: So könnte ein Stoff, der nach CLP/GHS-Verordnung 2015 neu als "gefährlich" klassifiziert ist, andere Ausrüstungen für die persönliche Sicherheit der Mitarbeiter bedeuten. Bei rechtzeitiger Information könnten solche Änderungen vermieden werden, indem Anwender beispielsweise auf Ersatzstoffe zurückgreifen.
- Rechtzeitig auf die neue Marktsituation reagieren! Geschäftspartner können gezielt Produkte anfragen, die schon vor Ablauf der Fristen nach GHS/CLP umgestellt sind.
2. Richtig kennzeichnen – nutzen Sie unser Wissen
2.1. CLP/GHS-Verordnung 2015 – die neue Gefahrstoffkennzeichnung
Ziel der CLP/GHS-Verordnung 2015 ist es, dass Verbraucher die Gefahrenmerkmale chemischer Stoffe deutlich zur Kenntnis nehmen können. Im Sinne der Harmonisierung werden die Vorschriften für die Gestaltung der Kennzeichnungsschilder vereinheitlicht: Farben, Formate und Platzierung der Informationen sind hier genau definiert. Darüber hinaus ist in der CLP/GHS-Verordnung 2015 definiert, welche Kennzeichnungsschilder für die innere und äußere Verpackung genutzt werden müssen. Somit soll sich der Aufwand für die Unternehmen künftig verringern und doppelte Kennzeichnungsschilder für die Beförderung vermieden werden.
Was wird gemäß CLP/GHS gekennzeichnet?
Ein Stoff und ein Gemisch müssen gekennzeichnet werden, ...
... wenn sie als gefährlich gemäß der neuen Verordnung eingestuft wurden.
... wenn die Chemikalie einen Explosivstoff enthält (Anhang I, Teil 2.1).
... wenn ein Gemisch einen oder mehrere Stoffe enthält, die als gefährlich eingestuft wurden, auch wenn das Gemisch selbst nicht als gefährlich klassifiziert wurde. Dann muss das Gemisch entsprechend Anhang II, Teil 2 gekennzeichnet werden.
Wer ist für die Kennzeichnung verantwortlich?
Vor dem Inverkehrbringen müssen als gefährlich eingestufte Stoffe oder Gemische durch den Hersteller, Importeur, Verarbeiter oder Händler gemäß CLP/GHS-Verordnung 2015 gekennzeichnet werden. Händler können die Kennzeichnung des Lieferanten übernehmen, insofern sie nach der neuen Verordnung erstellt wurde. Das Gleiche gilt für den nachgeschalteten Anwender, wenn der Stoff oder das Gemisch nicht verändert wurde. In dem Fall muss eine neue oder ergänzende Kennzeichnung vorgenommen werden.
2.2. Welche Kennzeichnungselemente sind erforderlich?
Die Ergebnisse der Einstufung bestimmen die Auswahl der Kennzeichnungselemente: Bei einer harmonisierten Einstufung ist die Kennzeichnung festgelegt. Bei einer Selbsteinstufung sind die zu verwendenden Kennzeichnungselemente in den Teilen 2 bis 5 des Anhangs I der CLP/GHS-Verordnung 2015 definiert. Die detaillierten Bestimmungen zur Kennzeichnung und die Ausnahmen finden Sie in Anhang I Nr. 1.2 und 1.3, Anhang II sowie in Anhang III der CLP/GHS-Verordnung 2015.
Die wichtigsten Kennzeichnungselemente nach den alten und neuen Verordnung für Gefahrenstoffe gegenübergestellt:
Kennzeichnungselemente
| Stoff-/Zubereitungsrichtlinie 67/548/EWG bzw. 1999/45/EG |
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 |
| Gefahrensymbole und Gefahrenbezeichnungen |
Gefahrenpiktogramme |
| Bezeichnungen der besonderen Gefahren (R-Sätze) |
neu: Signalwort |
| Sicherheitsratschläge (S-Sätze) |
Gefahrenhinweis (H-Sätze) |
| besondere Kennzeichnungsvorschriften |
Sicherheitshinweise (P-Sätze) |
|
ergänzende Gefahrenmerkmale und besondere Vorschriften für ergänzende Kennzeichnungselemente (EUH-Sätze) |
Die neuen CLP/GHS-Gefahrensymbole: Darstellung und Regelung der Rangfolgen
Die orangefarbenen Rechtecke laut Stoff- und Zubereitungsrichtlinie werden nach Verabschiedung der CLP/GHS-Verordnung 2015 ersetzt. In dieser Übersicht sind die alten und die neuen Piktogramme einander gegenübergestellt. Neu sind die Piktogramme "Gesundheitsgefahr", "Ausrufezeichen" und "Gasflasche".
Die bisherigen Gefahrenpiktogramme:


Im Anhang V der CLP/GHS-Verordnung 2015 ist die Anwendung der Piktogramme beschrieben. Für die Gestaltung des Etikettes muss berücksichtigt werden, dass die CLP/GHS-Gefahrensymbole deutlich sichtbar dargestellt werden. Dabei ist vorgeschrieben, dass jedes CLP/GHS-Gefahrenpiktogramm mindestens ein Fünfzehntel der Fläche des Kennzeichnungsetiketts benötigt. Die Mindestfläche des Symbols muss 1 cm² sein. Wichtiger Hinweis: Wenn mehrere CLP/GHS-Gefahrenpiktogramme auf dem Kennzeichnungsetikett notwendig sind, dann wird die sogenannte Rangfolgeregelung (Artikel 26) angewandt, um die Anzahl der Symbole zu verringern.
Anwendung der CLP/GHS-Signalwörter
Hierbei handelt es sich um ein neues Kennzeichnungselement. Laut CLP/GHS-Verordnung 2015 gibt es zwei Signalwörter:
Signalwörter informieren über den relativen Gefährdungsgrad. Personen, die mit diesem Stoff oder Gemisch umgehen, sollen auf die Gefahr aufmerksam gemacht werden. Das Signalwort "Gefahr" beschreibt die schwerwiegenden Gefahren und ersetzt den Hinweis "Achtung", wenn beide Gefahrenklassen oder Differenzierungen vorliegen. Das Signalwort "Achtung" wird für die Gefahrenkategorien mit geringerer Gefahr eingesetzt.
Änderungen der Gefahrenhinweise gemäß GHS/CLP
Die Gefahrenhinweise (hazard statements) sind mit den bisherigen R-Sätzen aus der Stoff- und Zubereitungsrichtlinie vergleichbar. Diese standardisierten Textbausteine beschreiben die Art und den Schweregrad der Gefährdung. Sie werden mit auf das Kennzeichnungsschild aufgebracht. In der CLP/GHS-Verordnung 2015 gibt es eine Ausnahmeregelung für Kleinmengen: Verpackungen für Erzeugnisse von nicht mehr als 125 ml benötigen keine Gefahrenhinweise.
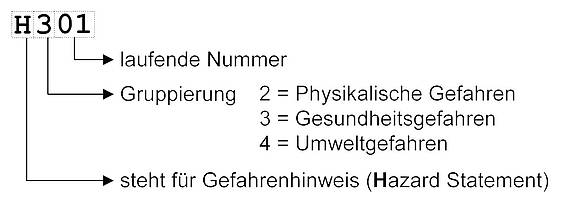
Sicherheitshinweise gemäß neuer Verordnung
Anhand dieser Sicherheitshinweise werden die empfohlenen Maßnahmen zur Begrenzung oder Vermeidung schädlicher Wirkungen von Chemikalien während der Verwendung formuliert. Diese standardisierten Inhalte sind vergleichbar mit den S-Sätzen aus der Stoff- und Zubereitungsrichtlinie. Im Anhang IV, Teil 1 der CLP/GHS-Verordnung 2015 sind die Kriterien für die Sicherheitshinweise festgelegt. So sollen beispielsweise maximal sechs Sicherheitshinweise verwendet werden, es sei denn, dass eine größere Anzahl aufgrund des Gefährdungsgrades notwendig ist. Auch hier gilt die Kleinmengenregelung.
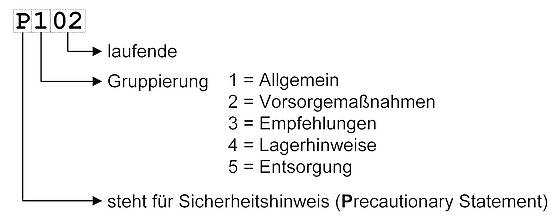
Produktidentifikatoren laut CLP/GHS-Verordnung 2015
Hierbei handelt es sich um Angaben auf dem Kennzeichnungsschild, die eine Identifizierung des Stoffes oder Gemisches ermöglichen (CLP/GHS-Verordnung 2015, Artikel 18). Diese Angaben müssen mit den Informationen im Sicherheitsdatenblatt übereinstimmen.
Angaben zum Lieferanten
Name, Anschrift sowie Telefonnummern des Herstellers, Importeurs oder sonstiger Lieferanten müssen auf dem Kennzeichnungsschild angegeben werden.
2.3. Wie werden Kennzeichnungsetiketten gestaltet?
Diese Angaben auf dem Kennzeichnungsetikett des Gefahrstoffes sind laut CLP/GHS-Verordnung 2015 obligatorisch:
- Name, Anschrift und Telefonnummer des Lieferanten des chemischen Erzeugnisses
- Nennmenge des Gefahrstoffes in der Verpackung, insofern nicht anderweitig angegeben
- Produktidentifikatoren
- CLP/GHS-Gefahrenpiktogramm
- Signalwort
- Gefahrenhinweise
- Sicherheitshinweise
- ergänzende Informationen
Darüber hinaus gibt es auch noch weitere formale Anforderungen an die neuen CLP/GHS-Gefahrstoffetiketten:
- Die Etiketten müssen fest auf die Flächen der Verpackung verklebt oder direkt auf die Verpackung gedruckt sein.
- Die Aufkleber sind waagerecht lesbar.
- Die erforderlichen Informationen über die chemischen Erzeugnisse müssen deutlich lesbar und nicht zu verwischen sein.
- Sprache: Stoffe werden in der Amtssprache des EU-Mitgliedsstaates gekennzeichnet, in dem sie angewendet werden sollen – oder in mehreren Sprachen, sofern die Lesbarkeit nicht beeinträchtigt wird.
Wir haben für Sie ein Beispieletikett gemäßGHS/CLP aufgebaut:
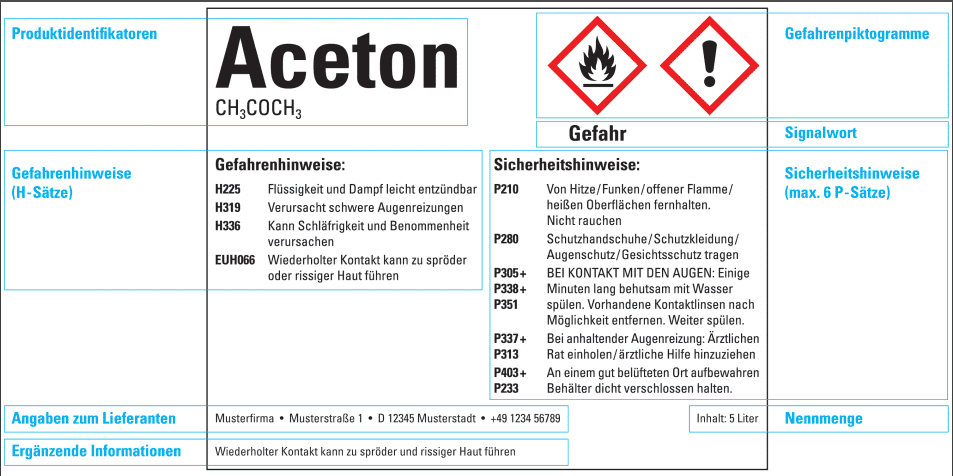
Größe der Kennzeichnungsetiketten
| Fassungsvermögen der Verpackung |
Abmessungen des Etiketts in mm |
| ≤ 3 Liter |
wenn möglich mindestens 52 x 74 |
| > 3 Liter, aber ≤ 50 Liter |
mindestens 74 x 105 |
| > 50 Liter ≤ 500 Liter |
mindestens 105 x 148 |
| > 500 Liter |
mindestens 148 x 210 |
3. GHS-Verordnung: Rollen und Aufgaben der Akteure in der Lieferkette
3.1. Definition der verschiedenen Akteursrollen
Die CLP/GHS-Verordnung 2015 legt für verschiedene Lieferanten bestimmte Verpflichtungen fest. Diese Pflichten hängen von der Rolle in der Lieferkette von Stoffen und Gemischen ab. Daher ist es wichtig, dass Unternehmen ihre Rolle gemäß der Verordnung bestimmen. Wir berichten über die Aufgaben gemäß der CLP/GHS-Verordnung 2015 für Lieferanten und Importeure sowie der sogenannten nachgeschalteten Anwender. In den folgenden Monaten werden wir über die Aufgaben von Händlern informieren.
Hersteller und Importeur
Der Hersteller ist eine natürliche oder juristische Person mit Sitz in der europäischen Gemeinschaft, die in der Gemeinschaft ein Erzeugnis herstellt oder zusammensetzt (Artikel 2, Absatz 15). Der Importeur ist ebenfalls eine natürliche oder juristische Person mit Sitz in der europäischen Gemeinschaft, die für die physische Einfuhr des chemischen Erzeugnisses verantwortlich ist.
Nachgeschaltete Anwender
Nachgeschaltete Anwender sind natürliche oder juristische Personen mit Sitz in der europäischen Gemeinschaft. Im Rahmen seiner industriellen oder gewerblichen Tätigkeit verwendet der nachgeschaltete Anwender chemische Stoffe oder Gemische. Händler und Verbraucher zählen nicht zu den nachgeschalteten Anwendern (Artikel 2, Absatz 19).
Händler
Bei den sogenannten Händlern handelt es sich ebenfalls um natürliche oder juristische Personen mit Sitz in der europäischen Gemeinschaft. Sie lagern Stoffe sowie Gemische und bringen diese an Dritte in Verkehr. Dazu gehören auch Einzelhändler (Artikel 2, Absatz 20).
3.2 Im Überblick: Verpflichtungen für Hersteller, Importeure, nachgeschaltete Anwender und Händler
GHS-Verordnung: Aufgaben für Akteure in der Lieferkette
Einstufung vor dem Inverkehrbringen
Sie müssen Stoffe und Gemische vor dem Inverkehrbringen gemäß GHS-Verordnung einstufen, kennzeichnen und verpacken.
-
Artikel 4, Titel I
- Absatz 2 regelt die Einstufung von Stoffen, die nicht in Verkehr gebracht wurden.
- Absatz 3 bezieht sich auf die harmonisierte Einstufung.
- Absatz 4 informiert über Kennzeichnung und Verpackung von gefährlichen Stoffen.
- Absatz 5 legt fest, dass Händler schon vorgenommene Einstufungen anwenden können (Händler).
- Absatz 6 gemäß dürfen auch Anwender bereits durchgeführte Einstufungen verwenden, wenn Sie die Zusammensetzung des chemischen Erzeugnisses nicht ändern (Nachgeschaltete Anwender).
Einstufung
Sie müssen die Gefahreneinstufung von chemischen Erzeugnissen gemäß Titel II vornehmen.
-
Artikel 5–14, Titel II
- Kapitel 1 (Art. 5–8) informiert über die Ermittlung und Prüfung von Informationen.
- Kapitel 2 (Art. 9–14) beschreibt die Bewertung der Gefahreneigenschaften und Entscheidung über die Einstufung.
- Nachgeschalteter Anwender: Wenn Sie die Zusammensetzung des Stoffes oder Gemisches verändert haben, dann müssen Sie diese Erzeugnisse gemäß Titel II einstufen.
Überprüfung der Einstufung
Sie müssen die Einstufung von Stoffen und Gemischen überprüfen. Wirken sich neue wissenschaftliche und technische Erkenntnisse auf die Einstufung aus, so muss eine Neubewertung vorgenommen werden.
-
Artikel 15, Titel II
- Absatz 2 regelt, dass Sie eine erneute Bewertung vornehmen müssen, wenn sich Konzentrationen oder Zusammensetzungen ändern.
- Absätze 3 und 4 beschreiben die Ausnahmen.
Kennzeichnung
Sie sind für die Kennzeichnung der chemischen Erzeugnisse verantwortlich.
Wichtig gemäß Artikel 30:
Bei jeder Änderung des Stoffes oder Gemisches müssen die Kennzeichnungsetiketten aktualisiert werden: CLP-Artikel 17–33, Titel III
Tipp: Informieren Sie sich ergänzend auf unserer GHS-Infoseite Richtig kennzeichnen – nutzen Sie unser Wissen.
Verpackung
Hersteller, Importeure, nachgeschaltete Anwender und Händler müssen gemäß GHS-Verordnung chemische Erzeugnisse verpacken.
-
Artikel 35, Titel IV
- Absatz 1 definiert die Beschaffenheit der Verpackung.
- Absatz 2 erläutert, dass die Ausführung der Verpackung für Verbraucher nicht irreführend und für Kinder gesichert ist.
Meldung der Agentur
Die Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen (Art. 39), die in Verkehr gebracht werden, müssen der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) gemeldet werden.
-
Artikel 40, Titel V
- Absatz 1 beschreibt, welche Informationen an die Agentur gemeldet werden müssen.
- Absatz 2 legt fest, dass der Agentur gemeldet werden muss, wenn sich an der Einstufung und Kennzeichnung des Stoffes etwas ändert.
- Absatz 3 definiert Meldefristen für Stoffe ab dem 01.12.2010.
Harmonisierte Einstufung
Liegen Ihnen neue Erkenntnisse über einen Stoff vor, so müssen Sie dieses melden.
-
CLP-Artikel 37, Titel IV
- Absatz 6 regelt, dass Sie der zuständigen Behörde des Mitgliedstaates einen Vorschlag vorlegen müssen, wenn Ihnen Änderungen über die harmonisierte Einstufung und Kennzeichnung eines Stoffes bekannt sind.
Informationsaufbewahrung
Sämtliche Informationen über einen Stoff müssen von Ihnen gesammelt und für einen gewissen Zeitraum aufbewahrt werden.
-
Artikel 49, Titel VII
- Absatz 1 legt fest, dass Sie als Lieferant alle Informationen, die zur Einstufung und Kennzeichnung genutzt wurden, recherchieren und diese für einen Zeitraum von 10 Jahren nach der letzten Lieferung des Stoffes archivieren.
- Absatz 2 regelt diesbezüglich den Fall einer Geschäftsaufgabe bzw. Übertragung der Tätigkeit an Dritte.
- Absatz 3 definiert das Vorgehen der Informationsabfrage durch Behörden.
- Händler müssen darüber hinaus auch Informationen mindestens 10 Jahre aufbewahren, die von einem anderen Akteur der Lieferkette für die Einstufung und Kennzeichnung erstellt worden sind.
Quelle: Broschüre der europäischen Chemikalienagentur „Einführende Leitlinien zur CLP-Verordnung" (2009)
4. CLP/GHS-Verordnung 2015: Mehraufwand für Ihren Arbeitsschutz?
Wann müssen Sie Ihre Gefährdungsbeurteilungen überprüfen?
Unternehmen, die Stoffe und Gemische ausschließlich anwenden (nicht selbst herstellen oder die Zusammensetzung verändern), müssen sich auf Neuerungen und erhöhten Aufwand im Bereich Gefahrstoffkommunikation einstellen. Viele Stoffe und Gemische werden aufgrund der geänderten Einstufungskategorien und -grenzen gemäß der CLP/GHS-Verordnung 2015 neu eingestuft. Es gibt Gefahrstoffe, die beispielsweise nach der alten Einstufung als „gesundheitsschädlich" und nach GHS/CLP als „giftig" kategorisiert werden. Dieses hat Auswirkungen auf den täglichen Umgang mit solchen Stoffen und Gemischen – und somit auch auf weitere Arbeitssicherheitsmaßnahmen. Erhalten Sie als sogenannter nachgeschalteter Anwender einen chemischen Arbeitsstoff mit der neuen Kennzeichnung, dann sollten Sie folgende Schritte einleiten:
- Kontrollieren Sie in jedem Fall sorgfältig das neue Sicherheitsdatenblatt des Stoffes auf Änderungen, die sich ggf. aus der Stoffbewertung nach der Reach-Verordnung ergeben haben! In dem Sicherheitsdatenblatt sind mehr Informationen über den Gefahrstoff enthalten als auf dem Etikett, das nur der ersten Warnung dient. Aufgrund der neuen Stoffbewertung durch die Reach-Verordnung kann es weitere Erkenntnisse über die Gefahren geben. Diese Informationen sind in dem Sicherheitsdatenblatt enthalten.
- Wurde der Stoff oder das Gemisch gemäß CLP/GHS-Verordnung 2015 neu eingestuft? Sie müssen eine Gefährdungsbeurteilung durchführen, wenn es neue Erkenntnisse über Gefahren gibt und diese zu einer Neubewertung geführt haben. Bei einer veränderten Klassifizierung des Stoffes (z. B. von gesundheitsschädlich zu giftig) werden neue Schutzmaßnahmen erforderlich sein. Gibt es keine Modifikationen des Produktes, dann können Sie die bisherige Gefährdungsbeurteilung weiter verwenden. Trotzdem sollten Sie das Ergebnis dieser Prüfung dokumentieren.
Wichtiger Hinweis: Noch keine Änderung bei Gefahrstoffverordnung und TRGS
Bis zum Ende der Übergangsfrist (01.06.2015) gilt das bisherige Schutzniveau gemäß der Stoff- und Zubereitungsrichtlinien. Dieses wurde in der Bekanntmachung IIIb3-35122 des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales veröffentlicht: „In der Gefahrstoffverordnung werden übergangsweise die Bezüge zur Einstufung nach den Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EWG, die erst zum 1. Juni 2015 außer Kraft treten, beibehalten. Mit diesem Vorgehen bleibt das bisherige Schutzniveau zunächst unverändert. Dies gilt auch für die bestehenden Technischen Regeln, die unabhängig von kurzfristig erforderlichen formalen Anpassungen zunächst unverändert Anwendung finden.”
Müssen Sie das Gefahrstoffverzeichnis aufgrund der CLP/GHS-Verordnung 2015 überarbeiten?
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin empfiehlt in der Bekanntmachung für Gefahrstoffe Nr. 408, dass während der Übergangsfristen in dem Gefahrstoffverzeichnis die alten und die neuen Einstufungen aufgeführt sind. Darüber hinaus muss das Verzeichnis auf dem aktuellen Stand sein und auf die Sicherheitsdatenblätter verweisen (GefStoffV § 7, Absatz 8).
Tipp: Nutzen Sie die GisChem-Datenbank, um Ihr Gefahrstoffverzeichnis zu erstellen. Diese Datenbank wird von der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie zur Verfügung gestellt. Sie informiert sowohl über die alte Kennzeichnung als auch die neuen GHS-Piktogramme und Gefahrenhinweise.
Sind die Betriebsanweisungen von der CLP/GHS-Verordnung 2015 betroffen?
Die Betriebsanweisungen müssen aktualisiert werden: Die neuen Gefahrenpiktogramme sowie H-Sätze sollten in Ihre Betriebsanweisungen eingearbeitet werden, sobald Sie Produkte mit neuer Kennzeichnung erhalten oder spätestens zum Ende der Übergangsfrist am 1. Juni 2015. Inhalt und Form der Betriebsanweisungen sollen nach wie vor den Empfehlungen der Technischen Regel für Gefahrstoffe 555 „Betriebsanweisung und Information der Beschäftigten" entsprechen (Absatz 2.2.4 „Gefahren für Mensch und Umwelt"). Demnach müssen die Betriebsanweisungen folgende Informationen beinhalten:
- Angabe der Gefahrenhinweise (nun H-Sätze) erfolgt im Wortlaut (nicht nur Zahlenkombination)
- Gefahrenpiktogramme können ergänzend dargestellt werden.
- Aufführung weiterer Gefährdungen, wenn sie für den Arbeitsplatz oder für die Tätigkeit relevant sind.
- Hinweis: Geben Sie auch die Signalwörter an, da diese die Gefährdung näher beschreiben.
Drei mögliche Varianten
Aufgrund der Übergangsfristen stellt sich auch hier wieder die Frage nach dem Umfang der Betriebsanweisung. In der „Bekanntmachung zu Gefahrstoffen" zeigt die BAuA (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin) drei mögliche Vorgehensweisen:
- Eine Betriebsanweisung mit alten und neuen Kennzeichnungselementen;
- Eine Betriebsanweisung mit alten oder mit neuen Kennzeichnungselementen und einem Hinweis, dass abweichende Kennzeichnungen auf dem Gebinde möglich sind;
- Parallele Verwendung von zwei Betriebsanweisungen: eine Ausfertigung mit alten und eine zweite Ausfertigung mit neuen Kennzeichnungselementen.
Wichtiger Hinweis: Sobald Sie Ihre Betriebsanweisung geändert haben, müssen Sie die betroffenen Mitarbeiter über die Neuerung unterweisen.
Was sollten Sie bei der innerbetrieblichen Kennzeichnung gemäß CLP/GHS-Verordnung 2015 berücksichtigen?
Während der Übergangsfristen (bis 01.05. 2015) ist grundsätzlich die innerbetriebliche Kennzeichnung der Gefahrstoffe nach beiden Systemen zulässig. Allerdings sollen sie nur so lange wie nötig parallel genutzt werden. Laut BAuA (Bekanntmachung zu Gefahrstoffe Nr. 408, 4.4) soll die gleichzeitige Verwendung der alten und neuen Kennzeichnungselemente auf Behältnissen oder Rohrleitungen vermieden werden. Ebenfalls für den Zeitraum der Übergangfrist wird eine vereinfachte Kennzeichnung empfohlen, bestehend aus:
- Name des Stoffes und Gemisches
- Gefahrenpiktogramm
- Signalwort
„Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist es in Ausnahmefällen möglich, die Anzahl der Piktogramme auf drei zu reduzieren (empfohlene Reihenfolge: GHS06 > GHS05 > GHS08 > GHS07 plus jeweils ein Piktogramm zur Kennzeichnung der physikalischen Gefahren bzw. der Umweltgefahr), wenn sichergestellt ist, dass die Beschäftigten über die Gefahren der Stoffe und Gemische entsprechend informiert sind.” (Bekanntmachung zu Gefahrstoffe Nr. 408, 4.4)
Diese kann für folgende Anwendungsfälle genutzt werden:
- Standgefäße in Laboratorie
- ortsfeste Behälter
- Rohrleitungen mit Gefahrstoffen, die sich nicht im Produktionsgang befinden
- Tankcontainer und Aufsetztanks für den innerbetrieblichen Verkehr
Wichtige Quellen für die betriebliche Kennzeichnung mit detaillierten Vorgaben:
- TRGS 200 „Einstufung und Kennzeichnung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen”
- ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung”
Zu welchen Inhalten müssen Sie Ihre Mitarbeiter unterweisen?
Sobald die neue Gefahrenkommunikation gemäß CLP/GHS-Verordnung 2015 in Ihrer innerbetrieblichen Kennzeichnung und in Ihren Betriebsanweisungen umgesetzt wird, müssen die betroffenen Mitarbeiter informiert werden. Die BAuA empfiehlt, die betroffenen Mitarbeiter über den üblichen Rahmen einer Mitarbeiter-Unterweisung hinaus zu dem Thema GHS/CLP zu schulen. Denn Mitarbeiter müssen von den Änderungen nicht nur erfahren, sondern sie auch verstehen!
Inhalte der Schulung oder Unterweisung sollten sein:
- Vorstellung der neuen Kennzeichnungselemente,
- Erklärung der wesentlichen Unterschiede zwischen dem alten und neuen System und
- Information über die Auswirkungen auf die tägliche Arbeit mit Gefahrstoffen.
Die Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie stellt in Ihrem Medienshop eine Vielzahl von Unterweisungshilfen gegen geringfügige Kosten zur Verfügung. Unter anderem finden Sie dort:
- „GHS-Zuordnungshilfe”,
- „GHS-Memospiel” und sogar
- ein „GHS-Skatspiel”
Ändert sich etwas an der Wahl der Schutzausrüstung durch die CLP/GHS-Verordnung 2015?
Die Auswahl der geeigneten Schutzausrüstung hängt in erster Linie von dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung auf der Grundlage der Stoffeigenschaften ab. Welche Arten von Schutzhandschuhen, Atemschutz, Schutzkleidung und Augenschutz eingesetzt werden sollen, muss im Sicherheitsdatenblatt des Stoffes enthalten sein (Bekanntmachung für Gefahrstoffe, Nr. 220). Hier muss der Lieferant beispielsweise beim Handschutz das Material und die Durchdringungszeit angeben. Bei der Benutzung von persönlicher Schutzausrüstung spielt die neue Einstufung und Kennzeichnung eine eher untergeordnete Rolle.
Rechtlicher Hinweis
Rechtlich verbindlich ist ausschließlich der Wortlaut der GHS/CLP-Verordnung 2015. Die hier vorliegenden Informationen sind weder vollständig noch rechtsverbindlich. Die auf diesen Seiten aufbereiteten Informationen sollen einen Überblick und eine Einführung zur Kennzeichnung nach der GHS/CLP-Verordnung 2015 geben. Daher empfehlen wir, sich im Falle einer Einstufung auf die Verordnung selbst zu beziehen.

ASR A 2.3 Gesetzesinfo
Die ASR A2.3 gilt für das Einrichten und Betreiben von Fluchtwegen und Notausgängen in Gebäuden sowie die Installation von optischen (lang nachleuchtenden) Sicherheitsleitsystemen, um im Gefahrfall das sichere Verlassen der Arbeitsstätte zu gewährleisten.
Die ASR A2.3 hat im März 2022 eine wichtige Aktualisierung erfahren! Unter anderem gibt die ASR A2.3 konkrete Vorgaben bezüglich der Beschaffenheit der Fluchtwege, z.B. Mindestlänge, -breite und -höhe und der erforderlichen Ausstattung von Fluchttüren und Notausstiegen. Die ASR A2.3 gibt vor, dass die Kennzeichnung der Fluchtwege und Notausgänge entsprechend der ASR A 1.3 erfolgen muss. Das Schild "Notausgang" muss lang nachleuchtend sein, wenn keine andere Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Die lang nachleuchtenden Sicherheitszeichen müssen mindestens den Anforderungen der DIN 67510-1, Klasse C entsprechen. Den kompletten Text der ASR A2.3 finden Sie auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin.
Begriffserklärung zur ASR A2.3
 Laut der ASR A2.3 sind Fluchtwege gewisse Wege, an die spezielle Voraussetzungen geknüpft sind und die bei der Flucht vor einer möglichen Gefahr benutzt werden. Es gibt einen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Fluchtweg. Der erste Fluchtweg wird aus den nötigen Verkehrswegen und Türen, Treppenräumen und Fluren sowie aus den Notausgängen gebildet. Der zweite Fluchtweg wird aus einem zweiten Notausgang gebildet, der zu einem Notausstieg ausgebaut sein kann. Gemäß ASR A2.3 ist die Länge des Fluchtwegs die kürzeste Strecke zu einem Notausgang. Der Unterschied zwischen einem Notausgang und einem Notausstieg ist, dass der Notausgang ein Ausgang im Verlauf des Fluchtweges ist. Der Notausstieg hingegen ist ein passender Austritt, um aus einem Raum flüchten zu können.
Laut der ASR A2.3 sind Fluchtwege gewisse Wege, an die spezielle Voraussetzungen geknüpft sind und die bei der Flucht vor einer möglichen Gefahr benutzt werden. Es gibt einen Unterschied zwischen dem ersten und dem zweiten Fluchtweg. Der erste Fluchtweg wird aus den nötigen Verkehrswegen und Türen, Treppenräumen und Fluren sowie aus den Notausgängen gebildet. Der zweite Fluchtweg wird aus einem zweiten Notausgang gebildet, der zu einem Notausstieg ausgebaut sein kann. Gemäß ASR A2.3 ist die Länge des Fluchtwegs die kürzeste Strecke zu einem Notausgang. Der Unterschied zwischen einem Notausgang und einem Notausstieg ist, dass der Notausgang ein Ausgang im Verlauf des Fluchtweges ist. Der Notausstieg hingegen ist ein passender Austritt, um aus einem Raum flüchten zu können.
Allgemeines zur ASR 2.3
Die ASR A2.3 besagt, dass Notausstiege, Notausgänge und Fluchtwege stets frei gehalten werden müssen, um jeder Zeit genutzt werden zu können. Sind diese von außen verstellbar, müssen sie gemäß ASR A2.3 gekennzeichnet werden.
Fluchtwege müssen im Allgemeinen deutlich gekennzeichnet sowie an gut sichtbaren Stellen angebracht sein. Türen, die manuell betätigt werden und sich in Notausgängen befinden, müssen in Fluchtrichtung geöffnet werden können. Des Weiteren müssen diese Türen leicht und ohne weitere Hilfe zu öffnen sein, sodass eine Person, die sich in Gefahr befindet, in der Lage ist, in die Freiheit zu gelangen. Das Gleiche gilt auch für verriegelbare Türen und Pforten.
Rettungswege müssen mit lang nachleuchtenden Schildern ausgestattet sein, sofern keine andere Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Die ASR A2.3 gibt auch vor, dass der Arbeitgeber für die geforderten Arbeitsbereiche einen Rettungs- und Fluchtplan erstellen muss. Dieser muss übersichtlich, stets aktuell, farblich hervorgehoben und gut lesbar sein. Der Flucht- und Rettungsplan muss zusätzlich die Regeln für das Verhalten im Brandfall sowie eine graphische Darstellung beinhalten. Der Arbeitgeber muss die Mitarbeiter über den Inhalt dieses Plans informieren.
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
Im Oktober 2012 wurde die (DIN EN) ISO 7010 veröffentlicht, welche seitdem die wichtigste Norm für die nationale / internationale Sicherheitskennzeichnung darstellt. 2020 ist eine konsolidierte Fassung neu veröffentlich worden. Die Zeichen sind ebenfalls in die überarbeitete Technische Regel für Arbeitsstätten (ASR) A1.3 eingeflossen, die im März 2013 veröffentlicht wurde, und für nahezu alle Arbeitsstätten in Deutschland gilt. Auch die ASR A1.3 wurde angepasst und ist seit März 2022 in einer aktualisierten Fassung anzuwenden.

Richtig kennzeichnen nach ASR A1.3!
Entscheidend für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung im Betrieb ist die ASR A1.3. Diese gilt für nahezu alle Arbeitsstätten in Deutschland. Die Technische Regel übernimmt die Zeichen aus der neuen (DIN EN) ISO 7010, die deutschlandweit und auch darüber hinaus gelten. Der TÜV Rheinland informiert hierzu: Arbeitgeber sind dazu angehalten, "... entweder die neue Beschilderung einzuführen oder eine Aktualisierung ihrer Gefährdungsbeurteilung durchzuführen". Letztere ist jedoch aufwändig sowie zeitintensiv und es gibt weder Ausnahmen noch einen Bestandsschutz für die bisherige Kennzeichnung. Noch ausführlicher können sie alles zum Thema ASR A1.3 in unserem kostenlosen Ratgeber zur Sicherheitskennzeichnung nach ASR A1.3 nachlesen.
Schnell und einfach mit den Sicherheitszeichen der aktuell gültigen Fassung der ASR A1.3!
Wenn Ihre Gefährdungsbeurteilung nach ArbStättV aufzeigt, dass Gefährdungen weder vermieden bzw. begrenzt werden können, ist die Kennzeichnung nach aktuell gültiger ASR A1.3 einzusetzen. Nur diese erspart Ihnen eine weitere Gefährdungsbeurteilung.
An dieser Stelle möchten wir Sie auf die DIN ISO 16069 hinweisen, die die Anwendung der Pfeilrichtungen für Ihren Fluchtweg definiert. Hierzu gibt die ASR A1.3 keine Hinweise. Schauen Sie sich dazu unseren Blogbeitrag an und sorgen Sie für eine eindeutige Kennzeichnung Ihrer Fluchtwege: Zum Blogbeitrag ➤
Des Weiteren besagt die ASR A1.3, dass lang nachleuchtende Rettungs- und Brandschutzzeichen anzuwenden sind, wenn keine Sicherheitsbeleuchtung vorhanden ist. Fluchtwege, die nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet sind, könnten Ihnen im Nachhinein Probleme bereiten. Schlagen Sie deshalb den sicheren Weg ein und kennzeichnen Sie lang nachleuchtend. Hierfür entthält die ASR A1.3 Vorgaben (Klasse C nach DIN 67510-1), die Sie mit unseren PERMALIGHT® power-Produkten uneingeschränkt erfüllen!
Die ASR A1.3: Vermutungswirkung geltend machen!
 Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) fordert im § 3a „Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten“ Abs. 1 auf:
Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) fordert im § 3a „Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten“ Abs. 1 auf:
Beim Einrichten und Betreiben der Arbeitsstätten hat der Arbeitgeber die Maßnahmen nach § 3 Absatz 1 durchzuführen und dabei den Stand der Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene, die ergonomischen Anforderungensowie insbesondere die vom Bundesarbeitsministerium für Arbeit und Soziales nach § 7 Absatz 4 bekannt gemachtenRegeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen. Bei Einhaltung der bekannt gemachten Regeln ist davon auszugehen, dass die in dieser Verordnung gestellten Anforderungen diesbezüglich erfüllt sind. Wer daher nach aktueller ASR A1.3 kennzeichnet, kann im Schadensfall die Vermutungswirkung, die Vorgaben der ArbStättV erfüllt zu haben, für sich geltend machen.
Experten-Empfehlung: Stellen Sie jetzt auf die aktuellen Zeichen um
- diese erfüllen die ArbStättV
- sorgen für rechtssichere Kennzeichnung
- vermeiden eine neue und zeitaufwändige Gefährdungsbeurteilung
Nach welcher Norm kennzeichnen Sie nun richtig?
Die ASR A1.3 ist jetzt nahezu für alle Arbeitsstätten verbindlich, sodass wir empfehlen für alle Bereiche gemäß neuer ASR A1.3 / DIN EN ISO 7010 zu kennzeichnen. Beachten Sie, dass eine Durchmischung von alter und neuer Beschilderung mit der neuen Regelung nicht vorgesehen ist. Den ausführlichen Text zur ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung finden Sie hier als pdf-Download bei baua
BGV A8 - veraltet
Bis März 2013 war die BGV A8 eine berufsgenossenschaftliche Vorschrift für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit. Sie galt für die Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz. Mit der Veröffentlichung der ASR A1.3 im März 2013 verlor die BGV A8 ihre Bedeutung. Der Inhalt dieser Unfallverhütungsvorschrift wird mit der Arbeitsstättenregel ASR A1.3 durch das staatliche Arbeitsschutzrecht abgedeckt. Wer die Sicherheitszeichen der nunmehr alten BGV A8 verwendet, muss in einer erneuten und zeitaufwändigen Gefährdungsbeurteilung sowie anschließenden Dokumentation feststellen, ob die alten Zeichen weiter verwendet werden dürfen. Die Voraussetzung zur Weiterverwendung ist, dass mit den alten Symbolen das gleiche Schutzniveau erreicht wird. Die Vermutungswirkung kann im Schadensfall jedoch nicht geltend gemacht werden. Dies nur bei der Anwendung der ASR A1.3 möglich.

Eine Gegenüberstellung ALLER betroffenen Kennzeichen finden Sie als Checkliste pdf-Download
Anhand der Liste können Sie alte und neue Kennzeichen direkt vergleichen.

BGR 191 Benutzung von Fuß- und Knieschutz
Die BGR 191 findet Anwendung auf die Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung und Benutzung von Fuß- und Knieschutz zum Schutz vor Verletzungen bei der Arbeit.
Der Text beinhaltet eine detaillierte Check-Liste zur Einordnung vorliegender Gefährdungen und zur Auswahlhilfe des richtigen Fuß- und Knieschutzes. Der genaue Wortlaut der BGR 191 steht hier für Sie zum Download bereit. Mit der Veröffentlichung der neuen DGUV Regel 112-191 ist die BGR 191 unwirksam geworden.
Zu den Sicherheitsschuhen
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung

BGR 194 - Benutzung von Gehörschutz
In Arbeitsbereichen mit hoher Lärmexposition ist der Unternehmer verpflichtet, den Mitarbeitern geeigneten Hörschutz zur Verfügung zu stellen.
Die BGR 194 beschreibt die erforderlichen Hörschutzmittel je nach Gefährdungsvorlage mit anschaulichen Beispielen und detaillierten Angaben der zulässigen Höchstwerte.
Den genauen Wortlaut der BGR 194 finden Sie zum Download in der BGVR-Online-Datenbank der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung.
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
Professioneller Gehörschutz
 Das Symbol "Biogefährdung" kennzeichnet konkrete biologische Gefahren. Dies sind Gefahren für Menschen und Umwelt, die von biologischen Substanzen oder Organismen ausgehen. Beispiele hierfür sind medizinische Abfälle, mit Mikroorganismen kontaminierte biologische Proben, Viren, Toxine aus biologischen Quellen usw. die für Menschen, Tiere oder Pflanzen usw.
Ausführliche und aktuelle Informationen zum Thema "Biologische Arbeitstoffe" finden Sie auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).
Das Symbol "Biogefährdung" kennzeichnet konkrete biologische Gefahren. Dies sind Gefahren für Menschen und Umwelt, die von biologischen Substanzen oder Organismen ausgehen. Beispiele hierfür sind medizinische Abfälle, mit Mikroorganismen kontaminierte biologische Proben, Viren, Toxine aus biologischen Quellen usw. die für Menschen, Tiere oder Pflanzen usw.
Ausführliche und aktuelle Informationen zum Thema "Biologische Arbeitstoffe" finden Sie auf der Website der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA).
- Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS)
- Rechtstexte zu biologischen Arbeitsstoffen (TRBA)
- aktuelle Beiträge zu biologischen Arbeitsstoffen u.v.a.m.
Zu den Warnschildern
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung
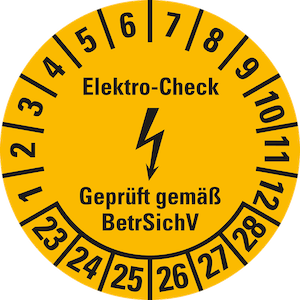
Was ist die DGUV Vorschrift 3?
Die DGUV Vorschrift 3, ehemals BGV A 3, ist die Unfallverhütungsvorschrift für elektrische Anlagen und Betriebsmittel.
Was besagt die DGUV Vorschrift 3?
Diese Unfallverhütungsvorschrift besagt, dass der Unternehmer dafür zu sorgen hat, dass alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel in einem Unternehmen nur von einer Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft nach den elektrotechnischen Regeln errichtet, geändert und instand gehalten werden dürfen. Der Unternehmer hat ferner dafür zu sorgen, dass die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel den elektrotechnischen Regeln entsprechend betrieben und alle 2 Jahre überprüft werden. Der genaue Wortlaut der DGUV Vorschrift 3, ehemals BGV A 3, steht für Sie zum Download bereit.
Zu den Prüfplaketten für die Prüfung elektrischer Geräte ➤
Wir halten Sie auf dem Laufenden!
Der Kroschke SIGN-Newsletter informiert Sie ausführlich zu aktuellen Gesetzesänderungen und interessanten Themen rund um die Arbeitssicherheit. Selbstverständlich kostenlos!
Zur Newsletteranmeldung ➤
Diese ASR konkretisiert die Anforderungen an das Einrichten und Betreiben von Verkehrswegen in § 3a Abs. 1 und § 4 Abs. 4 sowie der Punkte 1.8, 1.9, 1.10 und 1.11 des Anhangs der Arbeitsstättenverordnung. Verkehrswege sind dabei Bereiche, die für den Fußgänger- oder Fahrzeugverkehr oder die Kombination aus beidem bestimmt sind. Dies betrifft sowohl Außenbereiche aber auch Bereich in Gebäuden wie Flure oder Gänge.
Nicht in den Anwendungsbereich der ASR A1.8 fallen Zu- und Abgänge in, an und auf Arbeitsmitteln, Fahrzeuge und dazugehörige Anhänger, die für den Transport von Personen oder Gütern bestimmt sind, sowie Steigeisen, Steigeisengänge und Steigleitern, die ausschließlich als Angriffswege für die Feuerwehr dienen.
Die Arbeitsstättenregel verweist, sofern entsprechende Gefährdungen vorliegen, auch auf weitere ASR:
Was Sie beim Einrichten von Verkehrswegen beachten sollten
Oberstes Ziel ist der Ausschluss von Gefährdungen für Sicherheit und Gesundheit der Beschäftigten. Bereits bei der Planung und Einrichtung von Verkehrswegen ist dies zu berücksichtigen:
- Führen Sie Ihre Verkehrswege übersichtlich und möglichst geradlinig.
- Höhenunterschiede sollen vorrangig durch Schrägrampen ausgeglichen werden, für die je nach Nutzung eine maximale Neigung festgelegt ist.
- Beim manuellen Transport von Lasten muss die Belastung der Beschäftigten möglichst geringgehalten werden. Hier sind auch die Länge des Weges und das Gewicht der Lasten zu berücksichtigen.
- Stolperfallen im Bereich von Verkehrswegen z.B. durch Unebenheiten sind zu vermeiden. Oberflächen müssen eben und trittsicher sein. Der Belag soll so gewählt werden, dass er der maximalen Belastung standhält.
- Gefährdungen durch Absturz oder herabfallende Gegenstände sind auszuschließen (siehe auch ASR A2.1 Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefahrenbereichen).
- Kreuzungen und Einmündungen müssen übersichtlich und für die Verkehrsteilnehmer einsehbar sein, ggf. sind verkehrssichernde Maßnahmen zu treffen.
Wege für den Fahrzeugverkehr
Fußgänger- und Fahrzeugverkehr müssen grundsätzlich so geführt werden, dass Beschäftigte nicht gefährdet werden. Das gilt für Fußgänger wie Fahrzeugführer gleichermaßen. Die Mindestbreite von Wegen für den Fahrzeugverkehr richtet sich nach verschiedenen Faktoren wie
- der größten Breite des Transportmittels oder des Ladegutes
- des Randzuschlags
- des Begegnungszuschlages
- der Geschwindigkeit des Fahrzeugverkehrs
- der Zahl der Verkehrsbegegnungen
- den Wenderadien der Fahrzeuge (wichtig bei Kurven und Kreuzungen)
- Einsatz von Personenerkennungssystemen (beispielsweise bei fahrerlos betriebenen Transportmitteln)
Verkehrswege richtig kennzeichnen und abgrenzen
Nicht immer lassen sich Gefährdungen für die Beschäftigten durch technische Maßnahmen verhindern oder beseitigen. Unübersichtliche Betriebsverhältnisse können zusätzlich eine Gefahr darstellen. Gemäß ASR A1.8 sind Gefahrenstellen deutlich gemäß ASR A1.3 Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung zu kennzeichnen. Dauerhafte Gefahren werden mit gelb-schwarzen Markierungen gekennzeichnet, zeitlich begrenzte Gefahren mit rot-weißen Markierungen bzw. entsprechenden Sicherheitszeichen wie Warnzeichen.
Liegen Arbeits-, Lager- und Verkehrsflächen auf einer Ebene, sollten die Wege für Fußgänger- und Fahrzeugverkehr deutlich sichtbar am Boden markiert werden. Denkbar sind verschiedene Systeme wie dauerhafte Farbmarkierungen oder auch Markierungsleuchten. Abhängig vom Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung sind zur Abgrenzung von Verkehrswegen oder auch zur Trennung von Fußgänger- und Fahrzeugverkehr Geländer oder Leitplanken zu setzen.
Treppen
Treppen müssen leicht und sicher begangen werden können. Die Regelungen in der ASR A1.8 hierzu sind umfangreich, neben Begriffsdefinitionen finden sich darin unter anderem auch Maßgaben für die Abmessung des Auftritts oder den maximalen Steigungswinkel. Als besonders sicher gelten Treppen mit einem Auftritt von 29 cm und einer Steigung von 17 cm. Daneben gibt die ASR A1.8 ausführliche Hinweise zu Geländern und Handläufen. Besonders wichtig: Trittflächen müssen rutschhemmend ausgerüstet sein und dürfen keine Stolperstellen aufweisen.
Spezielle Vorschriften für Steigleitern, Steigeisengänge, Laderampen und Fahrtreppen
Die ASR A1.8 formuliert auch Anforderungen an Steigeisengänge und Steigleitern und enthält auch Vorschriften für deren Gestaltung und Einbau. Im Zusammenhang mit dem Schutz vor Absturz stellt die ASR A1.8 an mehreren Stellen eine Verknüpfung zur ASR A2.1 Schutz vor Absturz und herabfallenden Gegenständen, Betreten von Gefahrenbereichen her. Ab einer Fallhöhe von mehr als 5 m sind Einrichtungen zum Schutz gegen Absturz wie mitlaufende Auffanggeräte Pflicht. Bei Fallhöhen ab 10 m fordert die ASR den ausschließlichen Einsatz von Persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA).
Auch für Laderampen gelten spezielle Vorschriften wie eine Mindestbreite von 0,80 m oder der Mindestabstand zu festen Bauteilen beim Verkehr mit kraftgetriebenen Transportmitteln. Auch für Laderampen sind bei der Gefährdung durch Absturz entsprechende Sicherungsmaßnahmen zu treffen, wobei vorzugsweise Geländer zum Einsatz kommen sollten.
Fahrtreppen und Fahrsteige finden in der ASR A1.8 ebenfalls Erwähnung. Diese müssen europäischen und nationalen Normen entsprechen und für den Einsatz in Arbeitsstätten geeignet sein. Weitere Regelungen beziehen sich u.a. auf die Bemaßung des Stauraumes, Sicherheitsabstände und Not-Halt-Einrichtungen. Bei den angrenzenden Bodenbelägen ist darauf zu achten, dass die Rutschhemmung den Zu- und Abgängen der Fahrtreppen angepasst ist, um Stolper- und Rutschunfälle zu vermeiden.
Verkehrswege sicher betreiben
Im täglichen Betrieb können sich zahlreiche Gefährdungen bei der Benutzung von Verkehrswegen ergeben. Die ASR A1.8 führt beispielhaft einige auf:
- Kombinierter Fußgänger- und Fahrzeugverkehr
- Wechselndes Verkehrsaufkommen
- Verschmutzungen
- Witterung
- Vegetation
Bei der Entschärfung der Gefahren kommt es wieder auf die Gefährdungsbeurteilung an, in der abhängig von den Verhältnissen vor Ort geeignete Schutzmaßnahmen festzulegen sind. Dies können z.B. Verkehrsregeln, Warnkleidung, Markierungen oder Vorschriften für die Reinigung oder den Winterdienst sein. Wichtig ist auch die gefährdungsbezogene Einweisung der Mitarbeiter in die Benutzung der Verkehrswege und die Verkehrsregeln im Betrieb.
Weiterhin regelt die ASR A1.8, dass
- die erforderliche Mindestbreite von Verkehrswegen ständig freizuhalten ist,
- die Verkehrswege ausreichend zu beleuchten sind (vgl auch ASR A3.4 Beleuchtung),
- Transporte nur bei ausreichender Sicht über den Verkehrsweg durchgeführt werden dürfen,
- bei entsprechenden Sichtverhältnissen nur Fahrzeuge eingesetzt werden dürfen, die mit ausreichenden Beleuchtungseinrichtungen ausgerüstet sind,
- bei Transporten über Treppen eine Hand zum Festhalten am Handlauf frei bleiben muss und
- Lasten über Steigleitern nur dann von Beschäftigten transportiert werden dürfen, wenn beide Hände frei bleiben.
Bei Fahrtreppen (umgangssprachlich oft auch Rolltreppen genannt) ist auf die speziellen Gefährdungen hinzuweisen. Außerdem müssen aufeinander folgende Fahrtreppen mit der gleichen Geschwindigkeit betrieben werden. Bei Mängeln sind Fahrtreppen umgehend stillzusetzen.
Weitere Informationen zur ASR
Den Volltext der ASR A1.8 finden Sie wie immer auf den Seiten der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin BAuA .
Die Einrichtung sicherer Verkehrswege schildern wir beispielhaft auf unserer Seite zur betrieblichen Sicherheit auf dem Außengelände. Zusätzlich finden Sie alle passenden Produkte für Ihren individuellen Bedarf in den verschiedenen Sortimenten hier im Shop: